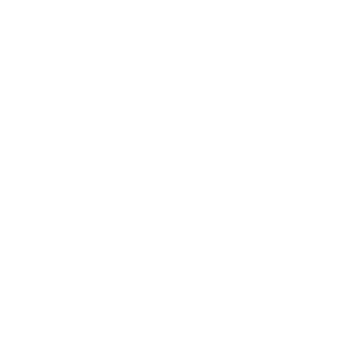Raed Saleh selbst sagt, er könne kein guter Moslem sein, wenn er sich nicht für die Vielfalt der Religionen einsetze und Angehörige aller Glaubensrichtungen vor Anfeindungen schütze – weshalb er vorschlug: „Eine Stadt, die Schlösser aufbaut, sollte auch Synagogen aufbauen.“1
Allerdings fehlt in der öffentlichen Resonanz auf diesen Vorschlag bislang eine fachlich fundierte Auseinandersetzung mit der Frage, ob der Wiederaufbau des Schlosses überhaupt ein richtiger Schritt war, der Schule machen sollte – oder ob er nicht vielmehr erst durch seine Umsetzung rückwirkend legitimiert wird. Berechtigt die Berufung auf bereits erfolgte Rekonstruktionen – unabhängig von ihrer historischen Vergleichbarkeit – dazu, Ähnliches andernorts wiederholen zu dürfen? Ist die Geste des äußeren Wiederaufbaus einer Synagoge nach historischen Plänen heute noch zeitgemäß – würde sie die Integrität des Judentums in Deutschland stärken, oder führt sie vielmehr dazu, dass das Leid und die Vernichtung der NS-Zeit vergessen wirken, als hätte es sie nie gegeben? Ist die Rekonstruktion ein Neuanfang – oder bereits der neue Anfang vom Ende, weil die Zerstörung durch ihre äußerliche Wiederholung nur noch als Subplot der Geschichte erscheint und nicht mehr so schlimm wirkt, wenn alles so leicht wiederaufgebaut werden kann? Müssten die Brüche der Geschichte nicht sichtbar bleiben, damit wir aus ihr lernen können? Wie lässt sich der Zerstörung gedenken, wenn sie im Stadtraum nicht mehr sichtbar ist? Ist es unter diesen Umständen nicht ein innerer Widerspruch, im Raumprogramm einen Gedenkort für die Erinnerung an die Zerstörung formulieren? Ist die Rekonstruktion Erinnerung – oder bereits Vergessens? Wie kann eine zeitgemäße Erinnerungskultur aussehen, wenn mit dem Verschwinden der letzten Zeitzeugen auch die schmerzende Leere jener Orte schwindet, an denen einst stolze Bauten standen – und eben diese Leere immer seltener als solche empfunden wird? Was bedeutet es, eine moderne Synagoge in Deutschland zu bauen? Und was heißt es, eine alte Synagoge zu rekonstruieren – eine, deren Geschichte nicht nur gebaut, sondern auch zerstört wurde? Kann beides überhaupt zusammen gedacht werden – oder birgt sich in der Gleichzeitigkeit bereits ein unlösbarer Widerspruch? Wenn ja – wie? Und vor allem: mit welcher Erzählung im Gepäck?

Synagoge Fraenkelufer, um 1959. Reste von Gravität – ein orthodoxes Gotteshaus, das noch Haltung wahrt, während die amtliche Auslöschung bereits vorbereitet ist…
Synagoge Fraenkelufer um 1959. © ullstein bild | ullstein bild.

…die Behörden nennen es Beräumung, die Photographie zeigt eine negative Liturgie: ein kurzer Rauchaufstieg als endgültiges „Amen“ aus Stein; der Körper verschwindet, die Verpflichtung des Ortes bleibt.
Architektur als Argument — Zwischen nationalem Narrativ und erinnerungspolitischer Verantwortung
Von der Wiederbesinnung auf die lange Geschichte des Judentums in Deutschland bis zur Sehnsucht nach den „guten alten Zeiten“ – „vor der großen deutschen Schuld“, wie der niederländische Kulturhistoriker Merlijn Schoonenboom2 in Bezug auf das Berliner Schloss formulierte –, von der (vermeintlichen) Normalisierung der Synagoge als selbstverständlichem Bestandteil deutscher Baugeschichte bis zur subtilen Abwertung durch das Ausklammern der historischen Singularität des industriell vollzogenen Völkermords, von der Hoffnung, man möge an einstige Blütezeiten des deutschen Judentums anknüpfen können, bis zur Resignation angesichts einer ungewissen Zukunft ohne gegenwärtige Entsprechungen – und schließlich vom Wunsch, der Toten zu gedenken, bis hin zum nicht minder legitimen Wunsch, wieder leben zu dürfen, legt der bloße Vorschlag der Rekonstruktion einer Synagoge an eben jenem Ort die gesellschaftlichen Brüche offen, die im glatten Gewand des Wiederaufbaus nur allzu leicht überdeckt würden.
Gerade weil sich unser Erinnern mit wachsender zeitlicher Distanz zu den einst markerschütternden Ereignissen nicht nur abschwächt, sondern transformiert – und wir uns daher in einem Zustand permanenter Selbstbefragung befinden, in dem stets aufs Neue zu klären wäre, wer wir sind und was uns ausmacht –, eröffnet dieser Ort die Möglichkeit, diese Frage zu stellen. Und vielleicht auch zu beantworten. Als exemplarischer Fall für das Spannungsfeld von Erinnerung und Zukunft kann die Synagoge am Fraenkelufer – in ihrer historischen wie ihrer künftigen Form – als Prüfstein für den erinnerungspolitischen Ernst unserer Zeit gelesen werden. Die vorliegende Arbeit versteht sich als Versuch, darauf eine Antwort zu geben – und als Einladung, darüber weiter nachzudenken.
Die Frage der Rekonstruktion lässt sich nur im Lichte unterschiedlicher Perspektiven angemessen betrachten – etwa jener nach ihrer Zielsetzung: Was soll mit ihr erreicht, was zurückgeholt, was überhaupt erinnert werden? Geht es darum, das Kaiserreich in Form der alten Synagoge symbolisch wiedererstehen zu lassen – oder soll das gegenwärtige, bunte Deutschland in die kaiserliche Kubatur gleichsam hineingelesen, ja hineingeschrieben werden? Und wenn Letzteres: wie?
Aus dieser Fragestellung ergibt sich unmittelbar die nächste – nämlich, weshalb uns überhaupt so viel an Rekonstruktionen gelegen ist. Sie verknüpft sich unweigerlich mit der Diskussion um die Authentizität des Materials und damit mit einem der zentralen Streitpunkte von Denkmalpflege und Rekonstruktionstheorie. Daraus lässt sich die prüfende Schlussfolgerung ableiten, ob – und in welchem Maß – das erklärte Ziel einer erinnernden Raumgestalt durch eine Rekonstruktion überhaupt eingelöst werden kann.
In seinem Beitrag „Baut die Synagogen wieder auf!“ – veröffentlicht am 9. November, jenem geschichtsträchtigen Datum, das für die FAZ-Ausgabe des Jahres 2017 mit Bedacht gewählt wurde – schreibt Raed Saleh, das einstige Gotteshaus habe „vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten für das stolze, selbstbewusste und heimatverbundene deutsche Judentum“ gestanden, und die düstersten Kapitel der Vergangenheit würden uns „allzeit mahnen […].“ Es gehe dabei, so Saleh weiter, nicht um eine individuelle Schuld heutiger Generationen von Deutschen; vielmehr trage die deutsche Gesellschaft eine Verantwortung für die Verbrechen der Vergangenheit – „nicht rückwärtsgewandt, sondern nach vorne blickend“. Diese Formulierung lässt zunächst eine Vision vermuten, die weniger auf die Reproduktion eines Vergangenen als vielmehr auf die Neuproduktion von Geschichte, Zukunft – und in der Folge von Raum – zielt.
Der SPD-Politiker führt weiter aus, das heutige Deutschland sei eines der „tolerantesten, weltoffensten, liberalsten, modernsten und fortschrittlichsten Länder der Erde“ – und zieht anschließend eine überraschende Parallele zum Kaiserreich: Auch die gegenwärtige gesellschaftliche Offenheit sei, so Saleh, das Ergebnis einer „immer schon auf Einwanderung gründenden und von der Vermischung der unterschiedlichsten Kulturen geprägten Gesellschaft.“
Zur Erinnerung: Um das Jahr 1890 habe das Deutsche Reich – direkt nach den Vereinigten Staaten – die zweithöchste Einwanderungsrate der Welt aufgewiesen. Nur sei das heute weitgehend in Vergessenheit geraten. Die gegenwärtigen Bauaktivitäten, so Saleh abschließend, trügen dieser historischen Realität jedenfalls keine Rechnung.
Am Ende seines Beitrags kritisiert Raed Saleh, dass alle bisherigen Rekonstruktionsversuche im besten Deutschland, das wir je hatten3 letztlich „halbherzig“ geblieben seien – man habe lediglich „Fundamente ausgegraben und wiedererrichtet“, nicht aber den Hochbau als solchen wiederaufgebaut. Gerade deshalb, so Saleh, müsse nun „ein starkes Zeichen“ gesetzt werden, indem die alte Synagoge als ein „zutiefst deutscher Ort“ wiedererrichtet werde. Man solle, wie er schreibt, „den Mut fassen und diesen Teil unserer nationalen Erzählung ebenso selbstbewusst bekräftigen wie das Deutschland der Schlösser und Kirchen.“ Zum Schluss bekräftigt Saleh: Er werde „den Wiederaufbau einer Synagoge wie der am Fraenkelufer auf jeden Fall unterstützen.“
Dass Raed Saleh mit Pathos das Wort ergreift, um dem Wiederaufbau der Synagoge am Fraenkelufer als eines „zutiefst deutschen Ortes“ das Wort zu reden, mag ihm als Akt politischer Klugheit erscheinen – als rhetorische Geste, die erinnerungskulturelle Verpflichtung mit nationaler Erzählung zu versöhnen sucht. Doch offenbart sich gerade in der stilistisch aufgeladenen, gleichwohl strukturell unbedachten Argumentation ein Dilemma, das exemplarisch ist für das Missverständnis, mit dem politische Repräsentanten sich allzu häufig an architektonische Debatten heranwagen: mit dem Herzen am rechten Fleck – und der Theorie denkbar fern.

Die geborgene Skulptur stammt vom originalen Berliner Schloss – alles andere ist Nacherzählung in Stein. Was wie Ganzheit erscheint, ist in Wahrheit die kunstvoll gefügte Behauptung eines Originals, das nur noch in Bruchstücken existiert.
© Daniel Yakubovich.
Kulisse oder Kultur? Über die Gefahr erinnerungspolitischer Selbstermächtigung
Saleh meint es zweifellos gut. Doch das Gutgemeinte mündet hier in eine Reihe von Versprechungen, deren semantischer Überschuss in eklatantem Missverhältnis zur architekturgeschichtlichen und erinnerungstheoretischen Substanz steht. Die Gleichsetzung von Synagoge und Schloss, von historischer Wunde und monarchischer Repräsentationswut, verrät mehr über das Bedürfnis nach Geschlossenheit des Diskurses als über seine Komplexität. Die Annahme, mit dem Wiederaufbau könne eine „nationale Erzählung“ vervollständigt oder gar geheilt werden, verkennt die eigentliche Zumutung jeder ernstzunehmenden Erinnerungskultur – nämlich, dass sie nicht auf Erlösung zielt, sondern auf Irritation, auf Unabgeschlossenheit, auf das Sichtbarmachen des Risses im Kontinuum der Geschichte.
Hinzu tritt die beinahe rührende, wenn auch beunruhigende Naivität, mit der Saleh architekturtheoretische Fragen in ein Set aus politischen Bekenntnissen übersetzt: als ließe sich die Frage nach Authentizität und Materialität, nach Form und Kontext durch den Rekurs auf historische Einwanderungsraten oder ein Zitat aus dem Bauordnungsrecht erledigen. Es gehört zu den besonders auffälligen Blindstellen seiner Rede, dass er den synagogalen Raum – dessen Entstehung, dessen Zerstörung, dessen erinnerungspolitische Schwere – auf eine nationale Kulisse reduziert, die er durch semantische Erhebung veredeln möchte. Doch das Pathos der Kulisse ersetzt nicht deren Gehalt.
Wenn nun gerade der Ruf nach Rekonstruktion in das politische Vokabular eines Mannes Einzug hält, der sich – nach eigenem Bekunden – der Toleranz und Weltoffenheit verpflichtet fühlt, so drängt sich der Verdacht auf, dass hier ein symbolpolitischer Reflex am Werk ist, der weniger mit der spezifischen Geschichte des Judentums in Deutschland zu tun hat als mit dem Wunsch, durch architektonische Geste eine gesellschaftliche Erzählung zu stabilisieren, die längst aus der Fassung geraten ist. Wo jedoch politische Sehnsucht auf erinnerungskulturelle Ambivalenz trifft, entsteht kein tragfähiger Bauplan – sondern ein monumentaler Irrtum.
Was dabei übersehen wird – vielleicht weil es schwerer zu fassen ist als Zahlen oder Zitate –, ist die Fragilität dessen, worum es in Wahrheit geht: nicht um Stein, nicht um Fassade, nicht um nationale Erzählung, sondern um den Raum dazwischen. Um das, was fehlt. Um die Lücke, die nicht zu schließen ist. Gerade dort aber beginnt Architektur als Gedächtnis. Wer dies übersieht – oder übergehen will –, läuft Gefahr, statt eines Denkmals der Erinnerung ein Monument des Selbstbetrugs zu errichten.
Gerade in dieser Konstellation wird deutlich, dass die Gefahr einer allzu willfährigen Rekonstruktion nicht in der Tat selbst liegt, sondern in der Haltung, mit der sie betrieben wird: Wer das Wiederaufgebaute vor allem als Beweis nationaler Größe und zivilisatorischer Resilienz begreift, übersieht, dass Architektur – zumal an Orten historischer Gewalt – nicht bloß Körper im Raum, sondern Träger von Erzählung ist. Die Rückkehr zum Sichtbaren allein heilt nichts, wenn das Unsichtbare nicht zugleich erinnert wird. Eine Synagoge, die durch politische Deklamation wiederaufgerichtet wird, ohne dass die Fragilität ihrer Geschichte im Entwurf weiterlebt, ist nicht mehr als eine erbaute Beschwichtigung. Und eine Erinnerung, die nur in Stein gegossen, nicht aber in Form befragt wird, verkommt zur Illustration. Dass ein gewählter Repräsentant wie Raed Saleh inmitten dieser Debatte Begriffe wie „starkes Zeichen“, „mutiges Bekenntnis“ und „nationale Erzählung“ inflationär aneinanderreiht, ohne deren architekturhistorischen, geschichtspolitischen und semantischen Ballast zu reflektieren, zeugt nicht von visionärer Kraft, sondern von einem naiv überformten Gestaltungswillen, der das Unwiederbringliche mit dem Wiederherstellbaren verwechselt – und das Wiederaufgebaute mit dem wieder Gutgemachten.
Dass sich Politiker bei alledem auch selbst inszenieren müssen – als Advokaten des Fortschritts, als geborene Versöhner, als wortgewandte Gralshüter des interreligiösen Dialogs mit biographisch aufgeladenem Herkunftsbonus – liegt wohl in der Natur eines politischen Betriebes, der längst mehr Bühne denn Bürde geworden ist. Man kann ihnen diesen Reflex, sich mit der Aura des Guten zu umgeben und zugleich als Architekten einer moralisch aufgeladenen Zukunft aufzutreten, nicht gänzlich verübeln. Selbstvermarktung ist Teil der Profession, und wer heute keine Erzählung von sich selbst in Umlauf bringt, hat im politischen Diskurs kaum Aussicht auf Resonanz. Doch sollte man nicht in den Irrtum verfallen, diese narrative Beherrschung mit epistemischer Autorität zu verwechseln. Denn wo das persönliche Sendungsbewusstsein die komplexen Traditionslinien überstrahlt, droht nicht nur das Erinnerte im Schatten zu verschwinden – sondern auch die Ernsthaftigkeit der Debatte selbst.
Es wäre naiv zu erwarten, dass Politiker alles wissen. Doch es ist gefährlich, wenn sie es nicht wissen wollen – und umso entschlossener auftreten, je weniger sie reflektieren. Die Architekturgeschichte kennt für diese Haltung kein freundliches Wort, und auch die Erinnerungskultur tut gut daran, sich nicht auf das Parkett der Beliebigkeit ziehen zu lassen, auf dem jedes Zitat, jede Ruine, jede historische Linie nur mehr dekoratives Instrument politischer Selbsterzählung ist. Dass Bildung allein kein Garant für Haltung ist, steht außer Frage – aber dort, wo das kulturelle Gedächtnis einer Nation in gebauten Raum übersetzt wird, wo Erinnerung in Stein gegossen, Geschichte ausgestellt, Verlust symbolisiert und Zukunft gedacht werden soll, dort wäre ein Mindestmaß an Geistestiefe, historischer Sensibilität und architektonischem Differenzierungsvermögen keine elitäre Anmaßung, sondern schlicht Voraussetzung für die Würde des Unterfangens. Es sollte ein Ort der Zukunft entstehen, nicht eine Kulisse einer Vergangenheit, die man sich wieder zusammenkleistert, weil man ihre Brüche nicht erträgt.
Was bleibt? Vielleicht der leise Trost, dass jede Form der Überhöhung sich irgendwann selbst entlarvt – und dass der Raum, wenn er denn klug gedacht ist, mehr sagen kann als eine ganze Legislaturperiode. Alles Weitere aber – wäre Stoff für ein anderes Kapitel. Und womöglich auch für ein anderes Genre.
Siehe auch:


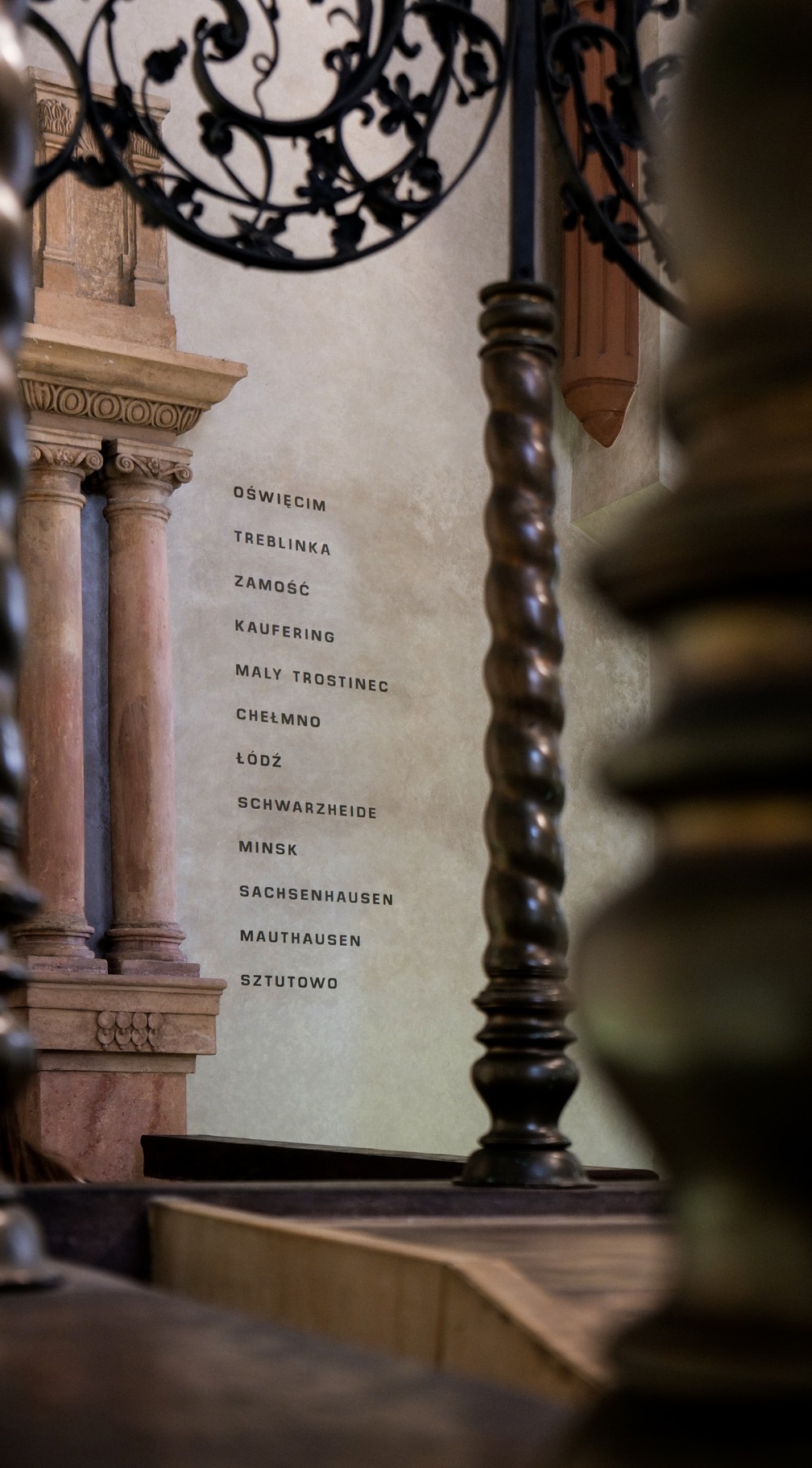
- Raed Saleh (09. November 2017), Baut die Synagogen wieder auf! FAZ ↩︎
- Merlijn Schoonenboom (17. November 2020), Ein Palast für die Republik. Eine kleine Geschichte der großen deutschen Suche nach Identität, Argobooks, Berlin ↩︎
- Bundespräsident Steinermeier bei einem Festakt und ökumenischen Gottesdienst in Potsdam zum 30. Jahrestages der Wiedervereinigung ↩︎