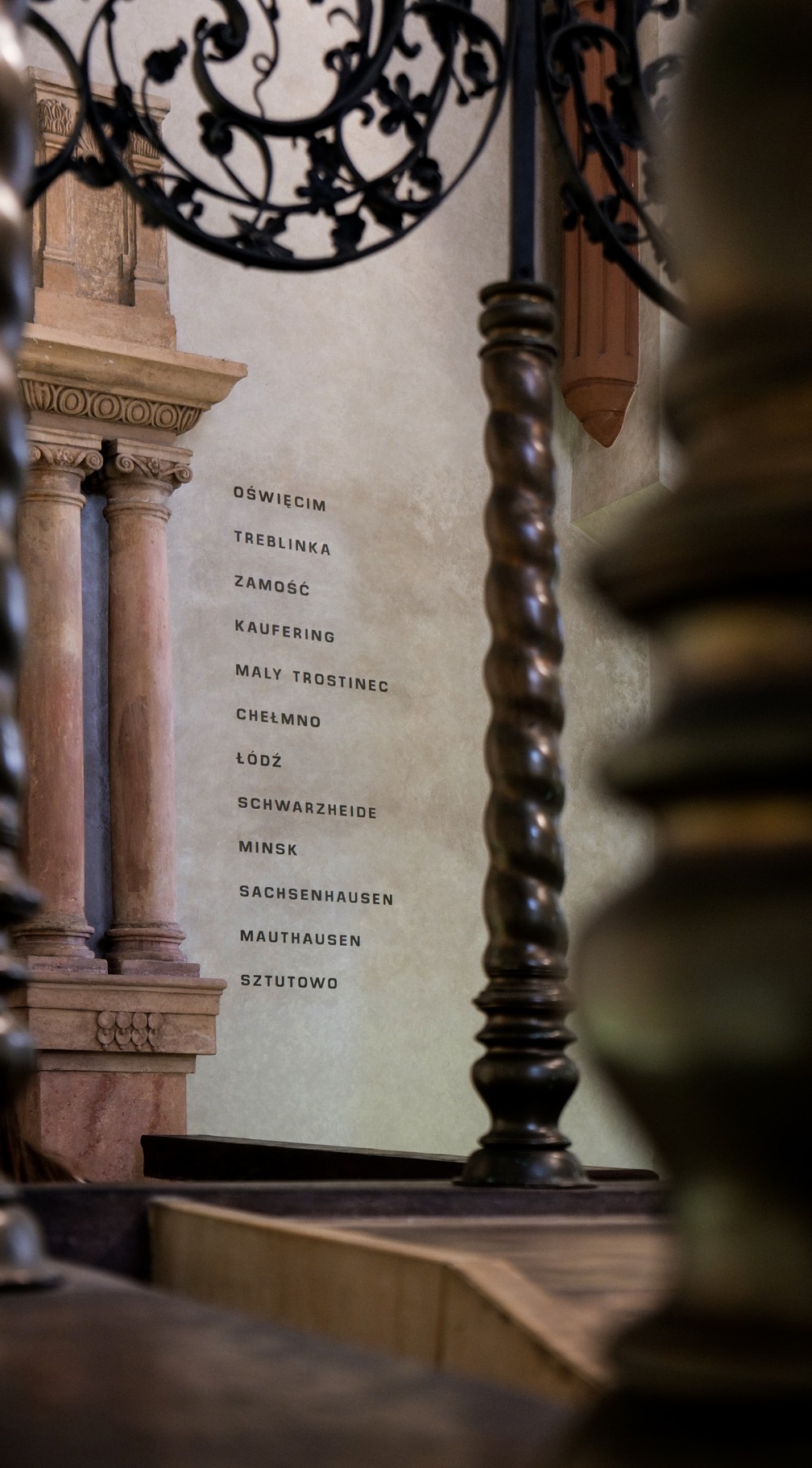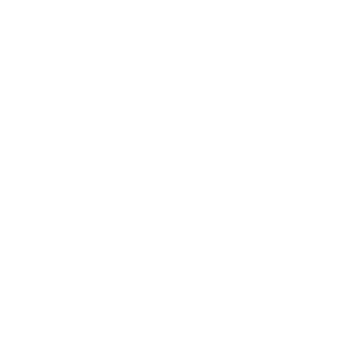Vom Ende und vom Anfang — Abschluss eines unabgeschlossenen Themas
Mit der vorliegenden Neuauflage soll ein Kapitel abgeschlossen werden, dessen Maß an persönlichen Verbindungen, professionellen Vernetzungen und ereignisreichen Verdichtungen kaum zu übertreffen ist. Als Ergebnis von jahrelanger Beschäftigung mit dem Synagogenbau am Berliner Fraenkelufer wurden die fundamentalen Fragen nach Erinnerung, Verantwortung und Identität in einem Maße aufgeworfen, das weit über die ursprüngliche Zielsetzung eines bloßen Entwurfes hinausreicht. Wie einleitend angemerkt, entstand die erste Auflage als zufälliges Nebenprodukt einer Bewerbungsmappe für den Einstieg in das Berufsleben. Es galt, die vielen, wichtigen Feinheiten des Entwurfes festzuhalten, weil weder in den Kolloquien noch in der Abschlusspräsentation Zeit dafür blieb.
Hingegen war die zweite Auflage ein bewusster Akt, um einen inneren Frieden mit dieser Synagoge zu finden und einen Schlusspunkt zu setzen. Im Russischen böte sich hier der Begriff закрыть гештальт [zɐˈkrɨtʲ ɡʲɪˈʂtalʲt] an. Dies kann wörtlich als das „Schließen einer Gestalt” übersetzt werden. Nicht nur wurde das deutsche Wort – wie so viele zuvor – eins zu eins ins Russische übernommen. Auch fehlt es der deutschen Sprache an einer bündigen Entsprechungen, um die ganze gestaltpsychologische Dimension der Synagoge Fraenkelufer als Lebensabschnitt für mich in Worte zu kleiden.
Insofern markiert die zweite Auflage nicht nur das Ende eines Werkprozesses, sondern auch den Übergang zu einem neuen Kapitel. Es ist das Ende von einem phasenweise forcierten, mitunter kämpferisch geführten öffentlichen Ringen um Sichtbarkeit, Teilhabe und erinnerungspolitisches Neudenken von jüdischer Architektur – hin zu einer ruhigeren, reflektierteren Nachwirkung, nachdem sich Erregung und Erbitterung gelegt haben und an Schärfe verloren. Vielleicht lässt sich dieses Moment am ehesten mit dem Schlussakkord einer Orgel vergleichen, der noch lange in den Sälen nachhallt und nach dem Ende des Gottesdienstes in den Gläubigen fortschwingt.
Dass so umfassende Lebensthemen wie „Rekonstruktion“, „Sakralbau“ oder auch die „Auseinandersetzung“ mit dem Religiösen nicht einfach „abgeschlossen“ und beiseitegelegt werden können, liegt in ihrer Natur. Es handelt sich um Fragen, die sich nicht lösen lassen, sondern immer wieder neu gestellt werden müssen. Die Schwingungen dieser Themen durchziehen das Leben in unterschiedlichen Frequenzen – einmal wie der tiefe Ruf eines Alpenhorns, dann wie ein schrilles Pfeifen, dann wie ein alarmierender, erweckender Schofar-Ruf und schließlich als kaum wahrnehmbares Summen. Die Beschäftigung mit der Synagoge Fraenkelufer wird – so viel ist gewiss – nicht verstummen, tritt jedoch leiser, stiller, in den Hintergrund zurück. Sie bleibt als Thema bestehen – als kaum hörbarer Nachklang, der aber nie ganz verebbt.
Entwicklung und Enttäuschung — ordnungsgemäß entschieden, inhaltlich verfehlt
Zudem führten die zunehmende Institutionalisierung der öffentlichen Debatte, das Ausbleiben inhaltlicher Anschlussfähigkeit und der formale Abschluss des Wettbewerbsverfahrens im Januar 2025 dazu, dass eine wirksame Teilnahme an der Debatte um den Wiederbau am Fraenkelufer faktisch endete. Der Raum für produktiven Widerspruch schien ausgeschöpft, die Argumente verhallt. Im Januar 2025 wurden Staab Architekten, gemeinsam mit Atelier Loidl Landschaftsarchitekten, als Gewinner eines einphasigen, nichtoffenen Realisierungswettbewerbs mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb bekanntgegeben. Ihr Entwurf orientiert sich nicht am historischen Bau Alexander Beers, sondern formuliert ein neues Ensemble aus drei Volumina mit einer Bruttogrundfläche von ca. 3 500 m² und einem Programm aus multifunktionalem Saal, Kindertagesstätte, Bildungs- und Veranstaltungsräumen, koscherem Café, Arbeitsräumen für gemeinnützige Initiativen sowie einer Ausstellungsfläche für zeitgenössische jüdische Kunst. Der Entwurf, getragen vom Verein „Jüdisches Zentrum Synagoge Fraenkelufer e. V.“ und von einem prominenten Kuratorium unterstützt, beansprucht hierfür bis zu 25 Mio. € aus öffentlichen Mitteln des Landes Berlin.
Das Preisgericht war fachlich hochkarätig besetzt; gleichwohl fehlte – soweit erkennbar – die systematische Einbindung nachweislicher Expertise in jüdischer Liturgie, Halacha, Sicherheitsarchitektur und erinnerungskultureller Semantik. Bei einem Synagogenbau ist diese Praxisnähe kein identitätspolitisches Ornament, sondern verfahrensnotwendig; ohne sie droht eine elegante, sichere, aber am Gegenstand vorbeigehende Lösung. Es erhärtet sich der Eindruck, der Gegenstand sei in Teilen als austauschbar behandelt worden – als ginge es um einen Mehrzweckbau, nicht um ein Gotteshaus einer der ältesten monotheistischen Traditionen –, weil die spezifischen Anforderungen jüdischer Sakralarchitektur nicht hinreichend verfahrensleitend wurden. Ein Synagogenbau ist kein gewöhnliches Bauvorhaben, sondern verlangt ein tiefes Verständnis ritueller und gesetzlicher Vorgaben (Ausrichtung und Blickachsen, Stellung von Aron ha-Kodesch und Almemor, liturgische Wegeführungen, Schabbat- und Feiertagslogistik, Fragen von Reinheit, akustische Dispositionen, Sicherheitsarchitektur unter realen Bedrohungslagen, erinnerungskulturelle Semantik der Form), das nur durch eine tatsächliche Vertrautheit mit gelebter Praxis in seiner inhaltlichen Tragweite erfasst werden kann; ohne dieses Wissen droht die architektonische Umsetzung die kulturelle und religiöse Dimension zu verfehlen – und zwar elegant, sicher, nur eben am Gegenstand vorbei.
Gerade deshalb ist die nachweisbare Einbindung jüdischer Praxis- und Halacha-Kompetenz kein identitätspolitisches Ornament, sondern ein verfahrens- und methodischer Mindeststandard; sie bringt jene Erfahrungsdimension ein, die in Lehrbüchern als Graphik existiert und im Alltag der Gemeinden Wirklichkeit ist. Zugleich – dies ist mir wichtig – ist der jüdische Hintergrund nicht das höchste oder alleinige Kriterium: Entscheidend ist die nachweisbare Kompetenz im Gegenstand, die Bereitschaft, sich der Halacha, der liturgischen Pluralität und den erinnerungspolitischen Implikationen auszusetzen, die Fähigkeit, diese Einsichten architektonisch zu übersetzen und sich dabei der eigenen Repräsentationsmacht bewusst zu bleiben. Herkunft ersetzt keine Expertise; aber Expertise ohne die Einbindung der Betroffenen bleibt, zumal in einem Feld, das Religion, Erinnerung und öffentliche Sichtbarkeit bündelt, strukturell unvollständig. Wer Synagogen baut, muss wissen, wovon er spricht – und mit wem. Nur dann entsteht ein Bau, der nicht bloß funktioniert, sondern trägt.
Auch die Kosten des Siegerentwurfes werden gegenwärtig (Stand 2025) mit 20–25 Mio. € veranschlagt; das Land Berlin stellt bis zu 24 Mio. € bereit. Die Erfahrung in der Projektsteuerung und in der unmittelbaren Arbeit mit öffentlichen Bauherrn und Zuwendungsempfängern ergibt jedoch ein nüchternes Bild: Baupreissteigerungen und Kostenexplosionen sind keine Ausnahmen. Der Umgang mit öffentlichen Mitteln ist nicht selten von einer Haltung geprägt, die Steuergelder als unbegrenzte Ressource betrachtet. Eine Erfahrung, die das Vertrauen in die wirtschaftliche Steuerung öffentlicher Bauprojekte erheblich relativiert. Die Grundsteinlegung ist für den 9. November 2026 vorgesehen – jenem Datum, an dem sich die Novemberpogrome zum 88. Mal jähren. Wie bei vergleichbaren öffentlichen Bauvorhaben wird auch hier zu beobachten sein, dass sowohl der zeitliche Rahmen als auch die finanziellen Dimensionen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht unverändert bleiben werden.
Damit steht die letztgültige, ausgeschriebene Entwurfsaufgabe im Gegensatz zu der anfänglichen, vom Berliner Schloss inspirierten Idee einer äußeren Rekonstruktion der Synagogenfassade nach historischem Vorbild. Dass diese Idee im Laufe des Prozesses verworfen wurde, lässt sich auch als Wirkung einer Diskussion deuten, die durch das vorliegende Projekt maßgeblich mitgeprägt wurde. Dass der Wettbewerb als geschlossener Wettbewerb organisiert wurde, schloss viele Stimmen aus. Junge, jüdische oder israelische Architekten waren nicht beteiligt. All das verweist auf ein tieferliegendes Spannungsverhältnis zwischen Repräsentation, Teilhabe und institutioneller Planungskultur in Deutschland.
Fanatismus und Fatalismus — neue Horizonte
Gegen diese Gemengelage aus ästhetischem Ehrgeiz, politischer Symbolik und haushalterischer Elastizität lässt sich ausführlich, mit Recht und notfalls kriegerisch bis zur totalen Abnutzung und geistigen Ermüdung argumentieren. Ein Buch, das vom Entwerfen handelt, sollte aber nicht im versteiften, cholerischen Dauerprotest enden oder die intellektuellen Positionsgräben vertiefen, wo sich die argumentative Front festgefahren hat, sondern in einer Haltungsänderung münden: Wenn die öffentliche Hand für ihr gutes historisches Gewissen teuer baut, ziehe ich meine Folgerung nicht im Modus der beleidigten Abkehr, sondern einer bewussten Neusortierung des Blicks. Künftige Energie gilt nicht dem Versuch, ein abgeschlossenes Verfahren zurückzuwickeln – das wäre im besten Fall nobel, ist aber im Regelfall fruchtlose Selbstbeschäftigung. Der Blick gilt dem, was in der hiesigen Debatte notorisch zu kurz kam: den kleinen, tragfähigen Formen von Raumkultur, die weder Wettbewerb noch Kuratorium benötigen und doch täglich darüber entscheiden, ob ein Ort lebt. Und es heißt, einen blinden Fleck offen zu benennen: Eine Synagoge entsteht nicht primär durch Wände, sondern – in orthodoxer Lesart – durch den Minjan. Wo zehn Männer die liturgische Schwelle bilden, definiert sich der Raum zuerst über Gebet, Zeitordnung und Beisammensein; der gebaute Rahmen folgt – und dient. In diesem Lichte wirkt der Reflex, das Gewissen mit einem pompösen Entwurf und maximalem Baubudget zu beruhigen, verführerisch – und zweitrangig. Konkret heißt dies eine Verschiebung vom ikonischen Volumen zur präzisen Ordnung der Dinge – Lichtführung und Akustik statt Renderperspektiven; die Stellung von Aron ha-Kodesch und Almemor im Spannungsfeld realer Gemeindewege statt Fassadenrhetorik; die unscheinbare, gleichwohl folgenreiche Choreographie von Alltag und Fest (Schabbat-Logistik, Sicherheit, Reinheitsfragen) statt Event-Architektur.
Der Blick gilt künftig einem Wechsel der Skala: weg von der Frage „Wie groß darf, wie teuer muss?“ hin zu „Wie wenig genügt, um Sinn zu stiften?“. Gemeint ist kein Moratorium auf große bauliche Gesten, wohl aber auf den Fetisch des Viel-und-Sofort. Wer Rekonstruktion ernst nimmt, rekonstruiert nicht zuerst Stein, sondern Glauben, Traditionen und Umgangsformen. Manches Monument erledigt sich dann von selbst – oder wird, wenn es entsteht, nicht länger zum Denkmal guter Absichten als Selbstzweck, sondern zum Mittel, zum Werkzeug für tatsächlich gelebtes jüdisches Leben. Vor allem bewahrt uns dieser Maßstab vor Synagogen, die als Showrooms schuldethischer Selbstvergewisserung auftreten und selbstinszenatorisch demonstrieren möchten, wie viel Gutes nach wie vor für Juden getan werde. Es werden Wellness-Oasen und Cafés errichtet — Räume, die alles können wollen – vom Yoga-Seminar bis zur Versöhnungsbühne. Flankierende raumprogrammatische Angebote mögen ihren Ort haben; ohne primären Kult- und Lernbetrieb bleiben sie jedoch Beiwerk – Räume, die vieles können wollen, nur das Eigentliche nicht zuerst.
Religiöse Praxis – und damit die Teilhabe am jüdisch-christlichen, abendländischen Erbe – wird in Europa seit Jahrzehnten an den Rand des öffentlichen Bewusstseins gedrängt; an ihre Stelle tritt eine symbolpolitische Ersatzsprache, die das Ritual musealisiert und die Gemeinde zum Publikum degradiert. Historisch lässt sich dieser Befund als Ergebnis einer langen Säkularisierungslinie lesen: Der berühmte Satz vom „Tod Gottes“ beschreibt dabei weniger einen Triumph als eine Diagnose des Bindungsverlusts – die Einsicht, dass die Welt nicht mehr selbstverständlich liturgisch getragen wird. Mit der Entzauberung der Welt (Weber) infolge ihrer schleichenden Intellektualisierung und Rationalisierung sowie der funktionalen Differenzierung der Moderne wanderten Glaubensvollzüge ins Private ab und das Heilige ins Ästhetische; aus der Feier wurde das Ereignis, aus der Gemeinde das Publikum, aus der liturgischen Praxis eine kuratierte Darstellung.
Diese Lage begünstigt die technokratische Fortschrittserzählung der Gegenwart, die den Menschen nicht als Geistwesen, sondern als optimierbares System betrachtet, seinen Körper als upgradbare Plattform, die Gemeinschaft als skalierbares Netzwerk. Was einst leibgebundene Würde und sittliche Ordnung trug, wird in Datenmodelle, Kennziffern und Governance-Rahmen übersetzt – effizient, messbar, folgenarm. Entscheidend ist, was daraus für den Bau folgt: belastbare, alltagsfeste Strukturen statt Symbolpolitik. Wo grundlegende anthropologische Konstanten – Leiblichkeit, Geschlechtlichkeit, Sterblichkeit, Verbindlichkeit – zu Parametern werden, verliert Liturgie ihren Ernst und auch das Recht seine Quelle; deshalb braucht der Kult räumliche Ernsthaftigkeit: klare Hörfelder, Lichtführung, Wege, Schutz.
Zugleich verschieben sich die demographischen Fundamente Europas: anhaltend niedrige Geburtenraten, zunehmend Alterung der Gesellschaft, Abwanderung qualifizierter Leistungsträger. Die Lücken werden durch Zuwanderung geschlossen – heterogen in Herkunft, Sozialisation und Religionspraxis. Wo Integration misslingt, Quartiere segregieren und importierte Konfliktnarrative auf lokale Fragilität treffen, entstehen Reibungen, die alte europäische Antisemitismen nicht ersetzen, sondern verstärken. Die Aufgabe der Synagoge wächst, verlässlich Bindung und Schutz im Alltag zu bieten.
Gerade deshalb verlangt der Blick auf die Synagoge eine Neusortierung: weniger Monument, mehr Mikro‑Institution; weniger Symbol, mehr Betrieb. Synagogen müssen – als belastbare Infrastrukturen der Bindung – Gebet, Lernen, Nachbarschaft, Schutz und Alltag tragen. In diesem Sinn ist die richtige Antwort nicht die nächste Repräsentationsfigur, sondern die präzise Pflege der kleinen Formen, in denen sich gemeinsames Leben bewährt. Sie füllt sich – wenn überhaupt – mit gelebter Bindung.
Daraus folgt ein schlichtes, anspruchsvolles Programm: Christen und Juden – Träger eines gemeinsamen abendländischen Erbes – sollten nicht erst beim Großprojekt zusammenfinden, sondern im Alltäglichen: in der Pflege der Liturgien, in der Gastfreundschaft zwischen Gemeinden, in der gemeinsamen Sicherung von Orten und in einer gemeinsamen Sprache über das Heilige, die ohne Kitsch auskommt. Aus solcher Haltung erwächst Form; und aus der Form Architektur, die trägt. Erst das Lebendige, dann das Repräsentative. Erst der Minjan, dann der Saal.
Wenn dieses Buch mit einer Richtungsangabe schließen soll, dann mit dieser: kleiner, präziser, dauerhafter und vor allem überlebensfähiger im kommenden Jahrhundert – statt groß, laut, modisch und verlässlich-vergänglich. Die Debatte um das Ensemble am Fraenkelufer mag ihren Lauf nehmen; meine Antwort ist kein Aufruf, sondern ein Angebot – an Gemeinden, Planer, Stifter und alle, die lieber funktionieren als posieren: eine Schule des Gebrauchs, ein Atlas der kleinen Formen, eine Werkstatt für das Nötige. Dann entsteht ein Raum, der nicht bloß funktioniert, sondern trägt.
Erst der Minjan, dann die Form.

© 2022 Daniel Yakubovich
Siehe auch: