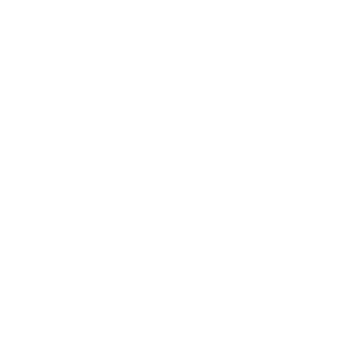Ornament und Gedächtnis – Teil II.
Über Enthäutung und Erotik, das Ornament als Konstruktion und die Fassade als Sprechakt

Für den Gefolterten muss sich die Häutung wie eine radikale Entgrenzung des eigenen Leibes anfühlen, in der der Körper seine schützende Haut als letzte Distanz zur Welt verliert und jeder Luftzug zur brennenden Berührung wird, bis Schmerz, Scham und Todessehnsucht ununterscheidbar ineinander übergehen. So soll der Apostel Bartholomäus in Großarmenien1 gemartert worden sein, nachdem er den König durch die Zerstörung von Götzenbildern und seine Predigt wider die paganen Kulte gegen sich aufgebracht hatte. Als Strafe wurde der Sohn des Tholmai2 gefoltert und bei lebendigem Leib gehäutet – in manchen Varianten anschließend gekreuzigt oder enthauptet –, weshalb er in der Ikonographie bis heute häufig mit einem Messer und seiner eigenen Haut über dem Arm dargestellt wird. Eine der bekanntesten kunsthistorischen Rekurse auf diese Szene findet sich in Michelangelo Buonarrottis Darstellung des Jüngsten Gerichts in der Sixtinischen Kapelle, wo der toskanische Maler, Bildhauer, Baumeister und Poet sein eigenes Gesicht in die gehäutete Hülle des Bartholomäus einschreibt und sich neben Christus in der Bildfläche verewigt. Somit muss Häutung — neben der Exekution — als äußerste Form der Strafe betrachtet werden, weil sie den Körper seiner schützenden Hülle beraubt und ihn zur bloßen Anatomie degradiert.
„Die zweite Haut kann man leicht wieder ablegen, die erste gar nicht und die dritte nur schwer“, schrieb der 2023 verstorbene Architekturhistoriker Wolfgang Pehnt3 – der treffend feststellte, dass zwischen unserer weichen Haut und der gebauten Umwelt als „dritter“ harter Haut4 nur das Mittelglied, nämlich die Kleidung, auswechselbar sei. Schon die Architekturkritik hat die gebaute Umwelt nach der Haut des Körpers und nach der Kleidung als „dritte Haut“ beschrieben, deren Aufgabe es sei, „Schutz und Ausdruck derer zu sein, die in ihr stecken“.5 Spätestens seit Gottfried Semper, der berühmte historistische Architekt und Namensgeber der gleichnamigen Semperoper, in seinen bekleidungstheoretischen Überlegungen6 das Ornament mit der Haut eines Bauwerkes gleichsetzte, drängt sich die Frage auf, was es über eine Epoche aussagt, wenn sie ihre Städte flächenhaft entkleidet. Je nachdem, welche Haut im Sinne Pehnts gemeint ist, kann Entkleidung also gleichbedeutend mit Erotik sein, aber auch mit inhumaner Folter und endloser Pein.
In einem strukturell verwandten Sinn hat die im 20. Jahrhundert dominierende, überwiegend ornamentkritische Moderne7 — vom frühen Funktionalismus und den Avantgarden der 1920er Jahre (Neues Bauen, Bauhaus, sowjetischer Konstruktivismus) über den International Style und die Nachkriegsmoderne bis hin zum seriellen Massenwohnungsbau aus Betonfertigteilen — ihre Häuser nicht nur entschmückt, sondern auch systematisch enthäutet, als sei jede Zier ein Verbrechen. Übrig bleiben Konstruktionen, die funktionieren, aber nicht mehr erzählen, Fassaden, die jede Spur von Rang, Geschichte und Gebrauch tilgen und nur noch Effizienz signalisieren. Warum nimmt eine Gesellschaft eine derartige Strafe an ihrem Stadtkörper hin – und verkauft sie sich selbst als Fortschritt? Kein Körper kommt ohne Haut aus, aber nur in der Architektur gilt die glatte Oberfläche als Ideal. Während der Komplexitätsdruck im Gebäudeinneren8 immer weiter steigt, soll die äußere Schicht möglichst nichts mehr erzählen – außer dem Versprechen von Effizienz. Genau an dieser Stelle beginnt der Konflikt zwischen Konstruktion und Ornament: dort, wo die Fassade entweder verstummt oder wieder zu sprechen beginnt.
Um zu verstehen, was bei dieser flächenhaften Entkleidung überhaupt verlorengeht, ist zunächst zu klären, was im gegenwärtigen architektonischen Diskurs unter „Ornament“ verhandelt wird.
Was ist Ornament heute?
In der Architekturdebatte meint „Ornament“ heute nicht nur Putten, Akanthusblätter und Blumenfriese, sondern jede bewusst gestaltete Mehrschicht über der nackten Konstruktion – alles, was über das rein Notwendige der Statik und Hülle hinausgeht und zugleich etwas mitteilt. Im Folgenden sei – heuristisch und bewusst vereinfachend – eine eigenwillige Unterscheidung vorgeschlagen, die sich abzeichnet, wenn man die Debatten von Semper über Loos bis hin zu neueren Diskussionen um digital-parametrische Ornamente (etwa bei Patrik Schumacher) verfolgt. Dazu zählen:
(1) tektonische Ornamente: Elemente, die aus der Konstruktion entspringen oder die Konstruktion lesbar machen, wie Gesimse, Lisenen, Kanneluren, Fensterrahmungen, die Lasten, Geschosse, Fügungen lesbar machen;
(2) ikonographisch-figürliche Ornamente: Elemente ohne konstruktiven Mehrwert wie Reliefs, Figuren, Wappen, Embleme, Schriftbänder, die Geschichten, Herrschaft, Religion, Berufe kodieren;
(3) abstrakte / geometrische Ornamente: Ziegelverbände, Fliesenmuster, Raster, Brüstungsfelder, die keine Figur erzählen, aber Rhythmus, Maßstab und Ordnung kommunizieren;
(4) material- und oberflächenbezogene Ornamente: Farbigkeit, Texturen, Fugenbilder, Patina, Wandmalereien, insb. Illusionsmalereien an Fassaden.
Im Folgenden ist mit „Ornament“ – sofern nicht ausdrücklich anders vermerkt – vor allem das tektonische Ornament (1) gemeint (Gesimse, Lisenen, Verdachungen, Bossen, Balustraden), in denen Tragwerk, Lastabtragung und Raumordnung lesbar werden. Blümchen und Putten werden hier ausgeklammert.
Der Stand der Forschung ist, stark verkürzt, grob dreigeteilt: Seit Gottfried Sempers Bekleidungstheorie wird Ornament als kulturelle „Haut“ des Bauwerks verstanden; seit Adolf Loos’ „Ornament und Verbrechen“ als umstrittenes Feld zwischen Moral, Ökonomie und Fortschrittsglauben; seit der Postmoderne (etwa bei Robert Venturi und Denise Scott Brown) erneut als eigenständige Sprache von Zeichen, Ironien und Kontextbezügen. In jüngerer Zeit treten digitale und parametrische Ornamente hinzu – CNC-Reliefs, 3D-gedruckte Fassaden, mediale Hüllen –, die zeigen, dass das Thema mit neuen Technologien eher wieder auflebt als verschwindet. Der vorliegende Essay fokussiert sich innerhalb dieses definitorischen Feldes ausdrücklich auf die tektonisch-archivalische Seite des Ornaments, die Lasten, Nutzung und Gesellschaftsordnung artikuliert — Gesimse, Profile und Stuck als Speicher von Konstruktion, Geschichte und sozialem Code. Florale, rein ikonische, „bloß dekorative“ Ornamente werden damit nicht negiert, aber aus der näheren Untersuchung ausgeklammert.
Das eigentliche Delikt der Moderne besteht nicht darin, Häuser entschmückt zu haben, sondern darin, ihren Schmuck für ein Delikt zu halten, ihn zu pathologisieren. In dem Moment, in dem Ornament zum Verdachtsfall erklärt wurde, verschob sich der Blick von der Konstruktion zur Moral: Gesimse, Profile, Pilaster sind nicht länger artikulierte Ränder einer tektonischen Logik, sondern bauwirtschaftliches Einsparpotential und Indizien für Verschwendung, Dekadenz, Rückständigkeit. Ohne die durchaus berechtigten hygienischen und ökonomischen Anliegen oder die Errungenschaften der Moderne, wie etwa des seriellen Bauens für die Massengesellschaft, zu leugnen, lässt sich doch feststellen, dass den Fragen von Ausdruck und Repräsentation ein forensischer Diskurs über Architektur als Nachhaltigkeitsbilanz9, Kostensaldo und als technoide Hülle trat, die ex lege10 nachgedämmt und nachgerüstet gehört. Die moralische Aufladung des Ornaments ist geblieben, nur die Semantik wechselte von einer Kritik an „bürgerlich-spießiger Maskarade“ und „hygienisch bedenklicher Materialverschwendung“ zu „energetisch problematischen“ und „nicht nachhaltigen Hülle“. Teile der ornamentkritischen Avantgarden und einer zunehmend entstuckungsfreudigen Baupraxis, begannen, Fassaden nicht mehr primär als codierte Aussagen zu lesen, sondern als Verdachtsflächen, an denen sich eine vermeintlich ‚schuldige‘ Überformung nachweisen lasse.11 Im Kern geht es um eine Verschiebung von der tektonischen zur moralischen Lesart der Fassade – und damit um eine Verstellung ihrer Semantik.
Was wir heute gemeinhin als Ornament bezeichnen, ist historisch überwiegend aus der Konstruktion hervorgegangen – auch wenn es stets eine parallel verlaufende Tradition rein ikonischer, nicht-tektonischer Ornamente gab. Aus der Distanz mag Ornament wie entbehrlicher Aufputz erscheinen; je weiter der Blick in die Geschichte, desto deutlicher werden die „dekorativen“ Schichten als Atavismen und Rudimente früherer Bauweisen lesbar. So wurde etwa die dorische Triglyphe seit Vitruv12 als steinerne Übersetzung hölzerner Balkenköpfe gedeutet, die Säulenkannelierung13 als Nachklang eines Baumstammes, als Licht-Schatten-Rille zur optischen Schlankung. Ornament war ursprünglich also die Grammatik, mit der ein Bau von Last, Fügung und Herkunft spricht. Dass der Historismus des späten 19. Jahrhunderts diese Grammatik bisweilen zur hohlen Rhetorik übersteigert hat, ändert an ihrem Sinn nichts.
Zugespitzt ließe sich konstatieren: Aus dem Holzbau ging ein Steinbau hervor, der den Holzbau tektonisch erinnert; aus dieser steinernen Übersetzung wurde mit der Zeit Maske, die sich von der ursprünglichen Bauweise löste – und Masken fallen, sobald ihre konstruktive Herkunft nicht mehr geglaubt wird.


Eine ähnliche Bewegung lässt sich auch heute beobachten: Die Raster der Schalungsanker im Sichtbeton, Fertigteilplatten oder dünne Betonvorsatzschalen, die rein gestalterisch gesetzt werden, serielle Lüftungsgitter, die sichtbar geführten Leitungen der High-Tech-, Industrial- oder Loft-Architektur, Paneele mit aufgesetzten „Schraubköpfen“ oder die lamellenartigen Sonnenschutzsysteme werden zunächst aus Gründen der Bautechnik gesetzt, dann tektonisch durchgestaltet – und schließlich als frei verfügbares Ornament kopiert, lange nachdem sich ihre ursprüngliche Notwendigkeit verflüchtigt hat. Was als konstruktive Notspur beginnt, endet als zitierfähige Oberfläche.
Dass Fassade als kommunikatives Medium prinzipiell weiterhin möglich ist, zeigen einzelne, hochgradig singuläre Beispiele – etwa Jean Nouvels Institut du Monde Arabe in Paris mit seiner mechanisierten Maschrabiyya-Fassade14, eine wahre Goldgrube für Wartungsfirmen, oder das mediale Fassadenkleid des Grazer Kunsthauses, das als friendly alien der historischen Altstadt bezeichnet wird und damit erstmalig beweisen könnte, dass manche Bauherrn und Planer nicht ganz von dieser Welt sind. Sie beweisen auch, dass Sprache an der Gebäudehaut nicht verloren gegangen ist, sondern vor allem in den Ausnahmefällen konzentriert wurde. Für die vorliegende Fragestellung der alltäglichen, seriellen Stadtfassaden sind solche Ikonen eher Symptome einer Verschiebung als deren Lösung: Die spektakulären Einzelstücke15 reden umso lauter, je stummer der normale Hintergrund geworden ist.

Paris, Institut du Monde Arabe (1981–1987, Jean Nouvel / Architecture-Studio). Photo: Fred Romero, Lizenz: CC BY 2.0.

Graz, Kunsthaus bei Nacht (Hyperillusion Graz, 2015). Photo: Markus Wintersberger, Lizenz: CC BY-NC 2.0, via Flickr.

Graz, Kunsthaus am Tage (2003). Photo: Heribert Pohl (Polybert49), Lizenz CC BY-SA 2.0, via Flickr.
Gründerzeitfassaden sind vor allem eins: räumlich!
Vertikale und horizontale Gliederungen – Sockel, Mittelzone, Kranzgesims, Erker, Balkone – erzeugen Plastizität und Tiefe der Fassade, Schattenwurf und Lichtspiel, einen abgestuften Übergang von Wand zu Öffnung. Diese Gliederungen unterliegen einer hierarchisch-strengen Ordnung, die auf die Besonderheiten des menschlichen Auges respondiert, weil sie in mehreren Maßstabsebenen zugleich operieren: Aus der Distanz erliest sich eine Grundfigur, die bei Annäherung in immer kleinere Gesten zerfällt – all die feineren Untergliederungen und Staffierungen. Die Fassade „ereignet sich“ als dynamischer Akt beim Flanieren und offenbart sich als fraktales System, in dem jede Maßstabsebene auf die darüberliegende mit einer eigenen, feineren Artikulation antwortet, so dass der Baukörper aus verschiedenen Entfernungen jeweils etwas anderes zu erzählen hat. All das reizt Auge, interagiert mit dem Körper und beschäftigt Hirn.
Wer die Stadt nicht nur als Ansammlung von Kubaturen, sondern als lesbare Ordnung begreift, bemerkt rasch, wie sehr der zeitgenössischen Architektur etwas abhandengekommen ist, was die Gründerzeit selbstverständlich beherrschte: die Fähigkeit, nicht nur zu funktionieren, sondern sich mitzuteilen. Die Gegenwartsfassade dagegen kennt diese zweite, kleinmaßstäbliche Erzählschicht oft nicht mehr. Ihr großes Bild – Raster, Plattenordnung, Glasband – bleibt aus der Nähe dasselbe wie aus der Ferne; die Oberfläche zeigt sich auch im Vorübergehen als weitgehend homogen. Was fehlt, ist nicht primär die schmückende Redundanz von Putten und Akanthusblättern, sondern eine räumliche Grammatik, die innerhalb der Flächigkeit der Fassadenabwicklung überhaupt erst ein Narrativ ermöglicht – ein grammatikalisches Grundgerüst, innerhalb dessen solche Phänomene notwendig werden können.
Zugleich ist der stilistische Pluralismus verlorengegangen, der ganze Gründerzeitquartiere bis heute trägt. Damals gab es eine „Einheit in Vielfalt“ (heterogene Homogenität), einen metrischen Grundtakt aus Blockrand, Traufhöhe und Bautiefe, innerhalb dessen dutzende Baumeister ihre je eigenen Variationen spielten – wie Bücher einer Reihe, jedes mit eigenem Rücken, aber alle im selben Format. Der heutige Neubau entsteht dagegen häufig auf groß zusammengelegten Parzellen, von wenigen Planerteams, als ein durchgehendes Markenobjekt; formale Auffälligkeit ersetzt fein abgestuften Detailreichtum.
Wie aber kam es überhaupt, dass die Gründerzeit sich diese Fülle leisten konnte?
Sie war das Produkt einer eigentümlichen Konstellation: rasantes Wachstum infolge der Industrialisierung und Urbanisierung, das Mietshaus als Anlageprodukt, ein Bürgertum, das seinen Aufstiegswillen noch in Stein und Stuck statt in Logos und Markenfarben formulieren musste – die Fassade als Reklame im Straßenraum, Ornament als Marketing, Statussignal und sozialer Kommentar. Möglich wurde diese Fülle auch durch eine makroökonomisch ausgesprochen vorteilhafte Konstellation möglich. Zum einen profitierte sie von den synergetischen Effekten der Reichseinigung und von einer Bauwirtschaft, in der Handwerk und Frühindustrie eine produktive Liaison eingingen. Zum anderen trug ein historistischer Bildungskanon dazu bei, der Stilatlanten, Musterbücher und einen gemeinsamen Takt aus Blockrand, Traufhöhe und Baufluchten bereitstellte. Diese ökonomisch-kulturelle Konstellation, die Ornament zugleich bezahlbar, normiert und aufwertend machte, ist heute verschwunden – und genau hier setzt der dritte Teil an, wenn von der gegenwärtigen Unmöglichkeit eines solchen Überflusses die Rede sein wird.

- Unter dem Begriff „Großarmenien“ wird heute ein staatliches Gebilde subsumiert, das – bei wechselnden Dynastien und Grenzen – etwa vom 3./2. Jahrhundert v. Chr. bis zur Absetzung des letzten Königs einer persischen Nebenlinie (sog. „Arsakiden“) im Jahr 5. Jahrhundert unserer Zeitrechnung bestand. ↩︎
- Bartholomäus gilt Form des semitischen Patronym Bar-Tolmai „Sohn des Talmai/Tholmai“. Der Personenname תַּלְמַי ist im Hebräischen des Tanach belegt (Bamidbar bzw. Numeri, also 4. Buch Mose 13,22 u. a.) und wird in der Fachliteratur als zugrunde liegende Form angesehen. ↩︎
- Wolfgang Pehnt, „Unsere dritte Haut“, Frankfurter Rundschau, 26.01.2019, online unter https://www.fr.de/kultur/unsere-dritte-haut-11512346.html (Zugriff am: 05.12.2025). ↩︎
- „Wesentlich ist nicht: Grundriss – Fassade – Dach, sondern ein Verständnis von dem Gebäude als der harten Haut.“ Bettina Götz / Richard Manahl, „Der Apparat der Formfindung – exemplarisch dargestellt an einem Teilaspekt des Bauens: dem Wohnungsbau“, in: UmBau 14, Österreichische Gesellschaft für Architektur, Wien 1993, S. 28–33. Online-Fassung: ARTEC Architekten, „Texte / Der Apparat der Formfindung“, abrufbar unter der Website der ARTEC Architekten (zuletzt eingesehen am 05.12.2025). ↩︎
- Vgl. Wolfgang Pehnt, „Unsere dritte Haut“, Frankfurter Rundschau, 26.01.2019, online unter https://www.fr.de/kultur/unsere-dritte-haut-11512346.html (Zugriff am: 05.12.2025). ↩︎
- Für Gottfried Semper sei Fassade aus einem Gewand entstanden, das die Konstruktion verhüllt. Diese stofflich-textliche Auffassung der Fassade als (Ge-)Wand und theatralischer Vorhang die entwurfstheoretischen Vorstellungen des 19. Jahrhunderts entscheidend geprägt. Zudem gilt Semper ohnehin als Mitbegründer der Theaterarchitektur.
Interessant sei in diesem Sinne folgedes: „Textrin war ein Sempersches Wort für textile Kunst. Vielleicht hat ihn die Etymologie der deutschen und germanischen Sprachen zu dieser Annahme verführt. In der Tat gehen Wörter wie ‚winden‘, ‚Gewand‘ und ‚Wand‘, also textile und architektonische Begriffe, auf dieselbe Sprachwurzel zurück.“ vgl. Wolfgang Pehnt, „Unsere dritte Haut“, Frankfurter Rundschau, 26.01.2019 ↩︎ - Mit „der Moderne“ ist hier kein einheitlicher Stil, sondern ein überwiegend ornamentkritischer Hauptstrom der Architektur des 20. Jahrhunderts gemeint, der – in unterschiedlichen politischen und ökonomischen Systemen – auf funktionale Rationalisierung, industrielle Standardisierung und eine „entkleidete“ Fassadensprache zielt. Er reicht vom frühen Funktionalismus und den Avantgarden der 1920er Jahre (Neues Bauen, Bauhaus, sowjetischer Konstruktivismus) über den International Style und die Nachkriegsmoderne bis hin zum seriellen Massenwohnungsbau aus Betonfertigteilen, etwa den chruschtschowschen Großsiedlungen der Sowjetunion nach dem Dekret zur „Beseitigung von Übertreibungen im Entwurf und Bau“ von 1955.
Gegenläufige Strömungen – wie die hochornamentale Repräsentationsarchitektur des sozialistischen Klassizismus oder regionale Ausprägungen einer tropischen Moderne in Lateinamerika und im Nahen Osten, die Ornament in klimaaktiven Gittern, Brise-Soleil und Musterfassaden fortschreibt – relativieren diese Tendenz, ohne ihren entornamentalisierenden Grundimpuls aufzuheben. Für die hier interessierende Frage nach Entstuckung und normativer Glättung der Fassaden ist daher weniger diese Vielfalt, als vielmehr die Grundtendenz entscheidend, der sich über beide politischen Blöcke hinweg in westlichen wie sowjetischen Nachkriegsstädten durchgesetzt und – nicht zuletzt über ökonomische und kulturelle Einflussnahmen – weltweit ausgebreitet hat.
Vgl. grundlegend Adolf Loos, „Ornament und Verbrechen“, in: ders., Ins Leere gesprochen, Wien 1931; Sigfried Giedion, Space, Time and Architecture. The Growth of a New Tradition, Cambridge, MA 1941; Kenneth Frampton, Moderne Architektur. Eine kritische Geschichte, München 2004; Wolfgang Pehnt, Die Architektur des 20. Jahrhunderts, München 2005; zur postmodernen Kritik und Rehabilitierung von Ornament u. a. Robert Venturi / Denise Scott Brown / Steven Izenour, Learning from Las Vegas, Cambridge, MA 1972. ↩︎ - Haustechnik, Leitungsführung, Brandschutz, Regelwerke, Verdichtung der Nutzung etc. ↩︎
- Vgl. zur Entstuckung als Massenphänomen in deutschen Städten im 20. Jahrhundert etwa Dankwart Guratzsch, „Verschont die Altstädte vor der Klimasanierung“, Die Welt, 24.08.2010, https://www.welt.de/channels-extern/ipad/kultur_ipad/article9774257/Verschont-die-Altstaedte-vor-der-Klimasanierung.html (Zugriff am: 05.12.2025). ↩︎
- Kraft Gesetzes ↩︎
- Für Berlin nennt der Berliner Mieterverein konkrete Größenordnungen: In Kreuzberg wurden zwischen 1954 und 1979 von rund 2.300 Altbauten etwa 1.400 Häuser ihrer Stuckfassaden beraubt; vgl. Andreas W. Voigt, „Erinnerungen an den großen Kahlschlag des Berliner Stucks“, MieterMagazin Online, Ausgabe 6/2023, Berliner Mieterverein, https://www.berliner-mieterverein.de/magazin/online/mm0623/erinnerungen-den-grossen-kahlschlag-des-berliner-stucks-062314.htm (Zugriff am: 05.10.2025).
Zur ideologischen Aufladung des Stucks als „bürgerliche Maskerade“ bzw. als kostenträchtiger, überholter Zierrat in Ost- und Westdeutschland siehe zusammenfassend „Entstuckung in Berlin“, https://www.chemie-schule.de/KnowHow/Entstuckung (Zugriff am: 05.10.2025). ↩︎ - Vitruv spricht in De Architectura (Buch IV, Kapitel 2) über die Ursprünge der dorischen Ordnung, einschließlich triglyphischer Dekorationen und hölzerner Elemente; vgl. Vitruv (Vitruvius Pollio), The Ten Books on Architecture, übers. von Morris Hicky Morgan (Cambridge, MA: Harvard University Press; London: Humphrey Milford, Oxford University Press, 1914), Buch IV, Kap. 2 (zur hölzernen Herkunft der dorischen Glieder: Triglyphen, Mutuli, Guttae). Digitale Ausgabe: Project Gutenberg, EBook #20239, https://www.gutenberg.org/files/20239/20239-h/20239-h.htm (Zugriff am: 05.10.2025). ↩︎
- Zur Deutung der Kanneluren und zur optischen wie tektonischen Funktion vgl. John Canning & Co., „Orders of Columns“, John Canning Company Blog, online unter https://johncanningco.com/blog/orders-of-columns (Zugriff am: 05.12.2025). ↩︎
- Der Begriff Maschrabiyya (arab. مشربية [maʃ.raˈbij.ja]) geht vermutlich auf die Wurzel SCH–R–B („trinken“) und die ursprüngliche Funktion als kühler Stellplatz für Wasserkrüge zurück. Im Biblisch-/Modernhebräischen gibt es die Wurzel ש־ר־ב (sch-r-b) in dem Substantiv שָׁרָב scharav = “glühende Hitze, Wüstenwind, Luftspiegelung / Mirage”. Aus arabisch schariba / scharāb haben sich über Persisch und Türkisch eine ganze Reihe von Lehnwörtern entwickelt: sherbet / Sherbet, sorbet, Sorbetto – und Sirup / syrup / sirop, jarabe (span.), xarope (port.) – alle letztlich von arab. scharāb / scharba(t) “Getränk, Sirup”. ↩︎
- Vgl. als prominente Gegenbeispiele zur hier beschriebenen semantischen Verarmung der Alltagsfassaden einige singuläre Bauten, in denen die Gebäudehaut ausdrücklich als kommunikatives Medium entworfen wurde: Jean Nouvels Institut du Monde Arabe in Paris (Fertigstellung 1987) mit seiner mechanisierten, auf der arabischen مشربية [mašrabīya] basierenden Lochblenden-Fassade, deren lichtregulierende Metallmembran zu einem zugleich klimatischen und symbolischen Filter wird. Wartungsfirmen werden sich sicherlich über volle Auftragsbücher freuen. Weiter, das Grazer Kunsthaus (2003) von Peter Cook und Colin Fournier mit der BIX-Medienfassade von realities:united, die die äußere Haut in eine niedrig aufgelöste Display-Oberfläche verwandelt und das Haus buchstäblich Sprechakte ausführen lässt; Peter Zumthors Kolumba in Köln (2007), wo ein durchlichteter Ziegelvorhang die Ruine der Vorkriegsbebauung aufnimmt und als poröse, erinnerungsgesättigte Hülle fortschreibt; die Schweizer Botschaft in Berlin (Diener & Diener, 2000) mit ihrer fein reliefierten Backsteinfassade, die tektonische Gliederung und atmosphärische Nuancierung verbindet; sowie Sergej Tchobans Museum für Architekturzeichnung in Berlin (2013), dessen Betonhülle durch eingeprägte Architekturzeichnungen selbst zum Träger einer zweiten, graphischen Erzählebene wird. All diese Beispiele zeigen, dass eine sprechende, semantisch aufgeladene Fassade keineswegs historisch unmöglich geworden ist, sondern sich heute eher in wenigen, hochgradig individualisierten und kapitalintensiven Ikonen der Kultur- und Repräsentationsarchitektur konzentriert. Gerade dadurch bestätigen sie allerdings indirekt die Diagnose einer normativen Glättung des seriellen Bestandes: Je mehr Bedeutung in einzelnen „Sonderfällen“ gebündelt wird, desto stummer erscheint der gewöhnliche Hintergrund der Wohn- und Zweckbauten, deren Hüllen als energetisch optimierte, aber weitgehend diskurslose Oberflächen in Erscheinung treten. ↩︎