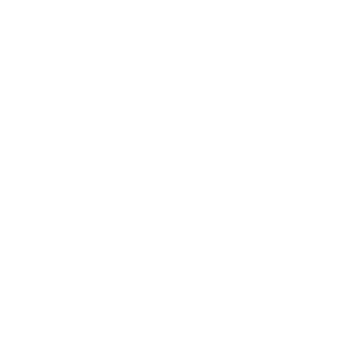Ornament und Gedächtnis – Teil III.
Zwischen Nekrophilie und Taxidermie, Normopathie und Bürokratie

In Berlin wirkt der Umgang mit der überlieferten vorkriegszeitlichen Stadttextur1 bisweilen wie ein Akt nekrophiler Fürsorge: Wir salben tote Flächen, legen ihnen neue Sandsteinhäute an, arrangieren sie mit Blumen und Infotafeln. Wir finden das in eigenlobtrunken formulierten Beschlussvorlagen als „Aufwertung“, „Stadtreparatur“ und „Quartiersentwicklung“ – als reichte formelhaftes Heraufsagen, um eine Entstellung in Genesung umzuwandeln. Dabei ist der Stadtkörper schwer entstellt; Kriegszerstörung, Abrisswellen, autogerechte Umbauten, spätere Korrekturen an den falschen Stellen haben ihm zugesetzt. Was wir berühren, ist oft nicht mehr das Gewachsene, sondern ein durch verwaltungsästhetische Leichenwäsche konservierter Stadtkörper in neuen historisierenden Blöcken. Dieses Stadtbildsurrogat wirkt geruchlos, charakterlos, gesichtslos und seltsam unberührt – als müsse die Stadt nicht leben, sondern vorzeigbar sein. Berlins Verhältnis zu seinem historischen Resterbe bleibt daher ambivalent: zu intim für eine Kulisse und zu künstlich für ein Leben.
Diese Ambivalenz – zwischen historischer Authentizität und Künstlichkeit – gebiert selten neues Leben, als vielmehr eine Art Totgeburt, die durch Taxidermie überhaupt erst als Stadt wieder in Erscheinung treten kann: vernäht, geschminkt und mit Geld bis zur Sättigung beschickt, damit sie so tut, als atme sie. Wer sehen will, wie diese Taxidermie aussieht, muss in Berlin nicht lange suchen: dort, wo historische Restbebauung als Erinnerung mitläuft – am Molkenmarkt2, am Petriplatz3, in der Berliner Mitte – und einen Steinwurf weiter4, wo dieser Kontext fehlt und Neubau großflächig emporwächst: in den Quartieren nördlich des Hauptbahnhofs, rund um die Heide- und Invalidenstraße5.
Doch es bleibt ein eigentümliches Unbehagen. Diese Häuser wirken selten wie selbstverständliche Teile eines organisch gewachsenen Stadtgefüges, sondern wie sorgfältig arrangierte Kulissen, in denen ein vergangenes Bild zur Ruhe gebracht werden soll. Die Fassade soll sich „einfügen“, keine Debatte auslösen, touristisch und medial verlässlich funktionieren. Sie beruhigt das schlechte Gewissen gegenüber der zerstörten Stadt, ersetzt aber kaum jene widersprüchliche Fülle, die verloren ging. Sie sieht „alt“ aus, funktioniert aber nicht wie „Alt“-Bau. Viele Fassaden sind Ergebnis von Gremiensynoden, Leitbildkanones, Gutachten- und Abwägungsritualen.6 Das Bild historisch gewachsener Zufälle wird durch eine neuartige Form stadtentwicklungspolitischer Totenschminke simuliert. Als Resultat erwächst auf zahlreichen Baustellen ein Konsenspanorama, als sei Werner Tübke beauftragt worden, sein Bauernkriegspanorama noch einmal zu malen – diesmal unter Aufsicht eines Gestaltungsbeirates, mit lückenloser Genehmigungslage vor Malbeginn, BNB-konformen Farbtönen, sorgfältig quotierter Vielfaltsstatisterie und Ablasszertifikaten für Nachhaltigkeit; aber ohne Wut, ohne Blut, ohne Bauern und ohne Krieg.




Die Stadt als Prozess: Produktion und Ökonomie
Beim Sezieren dieser Stadtleiche wird vor allem deutlich, dass es weniger um Ästhetikfragen als um den Entscheidungs- und Herstellungsprozess von „lebendiger Stadt“ geht. Es zeichnet sich ein Planungsprozess ab, der vor allem auf Konsensfähigkeit hin optimiert ist. So soll bei der Wiedererrichtung einer Berliner Altstadt zwischen Alexanderplatz und Schlossplatz, aber auch beim Schließen regulärer Baulücken ein Fassaden- und Stadtbild erzeugt werden, das ästhetische Anmutung und historische Lesbarkeit signalisiert, aber nicht die Kontingenzen ihrer Entstehung teilt.7 Entscheidende Bedingungen, unter denen viele Altbauten und Straßenzüge ihre physiognomische Dichte ausbildeten — handwerkliche Varianz, sukzessive Umbauten sowie Gebrauchsspuren und Patina — sind unter gegenwärtigen Produktions-, Haftungs- und Finanzierungslogiken nur begrenzt simulierbar. Die Folge ist eine antizipierte Endfassung: gebaut wird ein Idealzustand, der die zeitliche Genese nicht als offenes Werden in sich trägt, sondern sie durch Standardisierung, Nachweisführung und gestalterische Steuerung verkürzt. Damit verschiebt sich das Antlitz der historischen Stadt — nicht nur in Berlin — von einem sedimentierten und durch Ausverhandeln geprägten Bild — zu einer fixierten, kontrollierten Oberfläche.
Am Ende steht eine Architektur, die so sehr darauf bedacht ist, niemandem weh zu tun, dass sie auch niemanden mehr wirklich berührt. Hinzu kommt, dass die Gründerzeit mehr als ein Stil war, der imitiert werden kann. Die bis heute nostalgisch bewunderte Gründerzeit war eine Produktionsform sui generis8. Die heute noch begehrten Altbauten verdanken ihre lebhafte Wirkung und ästhetische Kraft einem Geflecht aus vielen mittelständischen kleinen Bauherren in Konkurrenz um Mieter und Fassaden als Aushängeschilder des dahinterliegenden Wohnkomforts, einem gemeinsamen Werkzeugkasten aus Musterbüchern und Stuckkatalogen sowie einem Handwerksbegriff, der mit Massenproduktion vereinbar war und serielle Elemente leicht rekombinierte oder abwandelte. Historismus war eine gesunde Liaison von Frühindustrie und Handarbeit, in der Wiederholung und Variation einander bedingten.
Über Jahrzehnte wurden diese Häuser umgebaut, umgenutzt und aufgebaut. Erdgeschosse wechselten von einer Werkstatt zum Ladenlokal, Balkone und Aufzüge wurden ergänzt, Portale verfremdet, Schilder angeschraubt, Leitungen nachgezogen, Wohnungen geteilt, Seitenflügel teilweise abgerissen. Die reich dekorierten und wohl proportionierten Fassaden, die uns heute ästhetisch ansprechen, sind keine abgeschlossenen Entwürfe, sondern Ergebnisse von Bodenspekulation und bürgerlichem Repräsentationswillen, von Baupolizei und Handlungsfreiheit, von Mangel und Überfluss. Ihre Schönheit ist nicht die eines perfekten Plans, sondern die einer unreinen, historisch heterogenen Oberfläche. Die Gründerzeitliche Heterogenität war emergent.
Wer darin eine sehnsuchtsvolle Flucht in das 19. Jahrhundert erkennen möchte, mag recht behalten. Aber die Sehnsucht nach dieser Epoche ist eine Suche nach einer verlorenen baukulturellen Intelligenz. Die Gründerzeit lieferte eine unübertroffene Grammatik von Licht, Schatten und Maßstäblichkeit, der es gelang, die aufkeimenden Ansätze moderner Reglementierung und industrieller Skalierung mit der Würde des körperlichen Wesens zu versöhnen – eine Ordnung, die gerade deshalb zeitlos bleibt, weil sie den Menschen nicht als statistische Größe, sondern als physisches Gegenüber begriff.
Simulation von Kontingenz unter Kontrollbedingungen
Kritische Rekonstruktion9 und zeitgenössisches Bauen in historischem Kontext funktionieren dagegen wie eine satanische Umkehrung. Sie sind nicht geworden, sondern von Beginn an ausgehandelt: größere Parzellen, weniger Investoren, einige Planerteams, ein einmaliger Entwurf, der Konflikte in Beiräten und politischen Gremien ausverhandelt.10 Was bleibt, ist ein Produkt, das die Widerstände hinter sich hat, nicht in oder vor sich. Die Häuser sprechen die richtigen Wörter, aber mit der falschen Intonation. So entsteht ein tragikomischer Cargo-Kult. Heutige Heterogenität ist oft kuratierte Varianz.
An dieser Stelle folgt der berechtigte Einwand, man solle lieber „in gute Grundrisse als in schöne Fassaden investieren“, als ließen sich Grundriss und Hülle voneinander trennen. In der Praxis fallen sie selten auseinander: Wo sich die Außengestalt eines Gebäudes auf das glatteste zulässige Minimum reduziert wird, entstehen innen oftmals genauso knapp kalkulierte, niedrige, schwer möblierbare Räume. Wo hingegen Sockel, Fensterbänder, Brüstungen und Traufkanten ernst genommen werden, verändert sich – durch die Wechselwirkung von Grundriss und Fassade – die ganze Raumökonomie: andere Höhen, andere Bezüge zum Straßenraum, andere Übergänge zwischen öffentlich und privat, andere handwerkliche Qualitäten.11
Wir müssen uns der Paradoxie stellen, dass uns der technische Fortschritt der letzten anderthalb Jahrhunderte einen beispiellosen Komfort im Inneren der Häuser geschenkt hat, aber allzu oft die Würde vor dem Haus geopfert hat. Während der gemeine Stand der Technik perfektioniert wurde, wurde dem Menschen durch Überregulierung in Technik und Gesetzgebung seine Freiheit genommen. In dieser Verschiebung liegt der eigentliche Verlust: Wir wohnen heute effizienter, aber wir treten weniger würdevoll in Erscheinung.
Ansätze einer neuen Fassadenkultur
(1) Ein erster Schritt liegt in der Rehabilitierung des Reliefs als Funktion. Entscheidend ist nicht, ob ein Kapitell historisch korrekt ist, sondern ob die Fassade plastisch gegliedert wird und aus den tatsächlichen Funktionen des Hauses entspringt: erkennbarer Sockel, tiefere Leibungen, ausgebildete Brüstungszonen, wirksame Traufkante. Wie in den vorangegangenen Teilen analysiert, sind Ornamente mehr als romantische Zitate: Sie leiten Regen um, werfen Schatten ab, erzeugen Nischen, markieren Übergänge, artikulieren das Tragwerk.
(2) Zweitens ist das Baukastenprinzip ernst zu nehmen – nicht als gesichtslose Großplatte, sondern als begrenztes, charakteristisches Repertoire: keramische Formsteine, profilierte Ziegel, gegliederte Betonfertigteile, perforierte Metallpaneele. Wiederholung hält Kosten und Planungsaufwand im Zaum; kontrollierte Varianz erzeugt jene leichte Unruhe, aus der adressierbare Häuser werden.
(3) Drittens lässt sich Ornament wieder als Informationsschicht begreifen: nicht als Bilderzählung, sondern als verdichteter Hinweis auf Ort und Gebrauch – gravierte Schriftzüge, Reliefbänder, abstrahierte Werkzeuge, transformierte Fragmente aus der Nachbarschaft. So wird die Fassade zum öffentlichen Archiv: kein Katalog fester Bedeutungen, sondern ein Speicher, in dem sich Lesarten überlagern und langsam sedimentieren. All dies ersetzt weder die verlorene Akteursvielfalt des gründerzeitlichen Baubooms noch die historische Zeit, die Patina und Widersprüche hinterlässt. Aber es markiert eine untere Schwelle: die Möglichkeit, in der Gegenwart Räume zu schaffen, die sich nicht von vornherein als kurzatmige Investitionen, sondern als ernstzunehmende Blätter im öffentlichen Archiv begreifen.
Die Kraft der Zahlen und die Ökonomie der Angst
Dass selbst solche bescheidenen Werkzeuge selten eingesetzt werden, liegt nicht an mangelnder Phantasie oder unkreativer Planung, sondern an einer eigentümlichen Unzahl an Normen, die in Normopathie umkippt: einer Baukultur, in der Richtlinien, Zertifikate und Nachweise zur eigentlichen Disziplin geronnen sind. Die Austreibung von Relief, Tiefe und Atmosphäre beginnt heute im Tabellenblatt. Dort, wo „optional“, „nicht förderfähig“ oder „kann entfallen“ stehen, werden Atmosphäre und Lebensqualität exorziert, bevor sie geplant und gebaut werden können. Teuer ist das Bauen in Deutschland nicht nur, weil Stein und Stahl mehr kosten, sondern auch weil sich um jedes Bauteil ein ganzer Apparat aus Gutachten, Nachweisen und Versicherungen gelegt hat. Gerade Vergabeverfahren der öffentlichen Hand erzwingen oft den billigsten Anbieter und im zweiten Schritt die teuersten Nachträge. Die eigentliche Bauleistung wird im Preis gedrückt, während Baunebenkosten, Dokumentations- und Steuerungsaufwand anschwellen – eine stille Umverteilung von der Mauer zum Papier, eine ausgelagerte Staatsquote, die sich als Privatwirtschaft tarnt, um es mit einem medial präsenten Vertreter der Österreichischen Schule zu sagen. So entsteht eine Bauwirtschaft der Angst, in der Fehlervermeidung höher bewertet wird als räumliche Qualität und am Ende häufig dort gespart wird, wo die Stadt es am deutlichsten spürt: an Fassade, Raumhöhe und Material.
Die Zahlen, auf die sich diese Rationalität beruft, sind real – Baukosten, Wartungskosten, Energiekennwerte –, aber sie werden in einer Form geführt, die fast ausschließlich Risiken, Haftungsfragen und kurzfristige Einsparungen abbildet. Was sich nicht in Formularfelder, Förderlogiken und Zertifikatsstufen übersetzen lässt – Proportion, Relief, Adressbildung, das leise Plus an Würde im Alltag –, taucht in dieser Buchhaltung selten auf. Dabei erzeugt ein Haus mit klar ausgebildeter Erdgeschosszone, erkennbarem Sockel und gut proportionierten Fenstern oft nachweislich höhere Nachfrage, stabilere Belegung, weniger Vandalismus; in den gängigen Kalkulationen erscheint davon nur eines: der Mehrpreis in der Bauphase.12 Man könnte hieraus den Schluss ziehen, der zwar bereits aucch viele totalitäre Systeme gezogen haben, dessen Richtigkeit aber dadurch nicht an Kraft verliert: Architektur erzieht den Menschen.
Diese Überlegungen münden in den zwei ewigen russischen Fragen, „Кто виноват?“ („Wer ist schuld?) und „Что делать?“ („Was ist zu tun?“)13, die als Romantitel bei Herzen14 und Tschernyschewski15 literarisch in Umlauf gebracht und von Lenin programmatisch zugespitzt wurden:
(1) Der Rotstift müsste dort ansetzen, wo sich Mittel ohne nennenswerte städtische Wirkung stauen – in doppelten Nachweisen, redundanten Versicherungen, überhöhten Sicherheitsaufschlägen –, und sie in sichtbare, räumlich wirksame Elemente investieren. Im internationalen Vergleich fällt schmerzhaft auf, wie sehr in Deutschland die Norm die Gestalt dominiert.16 Während anderswo Standardisierung Bauprozesse vereinfacht und Spielräume für Gestaltung öffnet, hat sich hier ein Normengefüge etabliert, das jede Abweichung als Gefährdung behandelt und die Architektur in eine ästhetische Notwehrhaltung zwingt.
(2) In einem zweiten Schritt müssten die Regelwerke selbst auf ihre Nebenwirkungen hin untersucht werden: Welche Vorgaben schützen tatsächlich Leib und Leben – und welche produzieren neue emergente Regelsysteme, die sich als unbeabsichtigtes Nebenprodukt der bestehenden Ordnung ausdifferenzieren? Wenn jede Profilierung als Haftungsrisiko, jede Materialkombination als künftige Regressquelle gilt, bleibt zwangsläufig nur die glatte, austauschbare Fläche übrig. Eine Baukultur, die ihren eigenen Mut nicht versichern kann, kleidet sich in moralisch aufgeladene „Zurückhaltung“ und verkauft ihre Angst als Tugend.
(3) Schließlich müsste auch die Ökonomie wieder als Verbündete begriffen werden. Digitale Fertigung, standardisierte, aber charaktervolle Bauteile und klar definierte Reliefzonen sind nicht naturwüchsig Kostentreiber, sondern können – richtig eingesetzt – den Wert einer Adresse, ihre Begehrlichkeit und Reparaturfähigkeit erhöhen. Solange Normen, Programme und Bewertungsraster räumliche Qualität weder erzwingen noch belohnen, bleibt die gut gestaltete Fassade als „weicher Faktor“ die erste Streichposition. Ökonomie als Verbündete zu denken heißt deshalb nicht, an Einsicht zu appellieren, sondern die Rahmenbedingungen so zu verändern, dass sich Großzügigkeit trotz kurzfristiger Zwänge lohnt – oder mindestens nicht permanent bestraft wird.
Blickt man auf die Gegenwart, könnte man meinen, das Ornament sei längst zurück. Doch vieles davon ist Effekt ohne Archiv: gelöst von Materialherkunft, lokaler Bautradition und codierter Bedeutung, austauschbar wie eine Oberfläche, die überall hängen könnte. So stehen sich kritische Rekonstruktion und moderner Effektschmuck als zwei Pole derselben Verweigerung gegenüber – hier die museal fixierte Kulisse, dort die kontextlose Spektakelhaut. Beide umgehen jene langsame, konfliktreiche Einschreibung, aus der die Gründerzeit hervorging. Gerade deshalb bleibt die Zumutung bestehen: Ornament ist kein Verbrechen – aber sein Ersatz ist es.
Progressive Nostalgie
Die vorangegangenen Texte rekonstruierten eine Verschiebung von materiellen zu semantischen und schließlich zu prozeduralen Verlusten. Die Reihe hat gezeigt, dass die Verflachung der Fassaden nicht primär aus ästhetischer Modenbildung oder technischer Unmöglichkeit resultiert, sondern aus einem Bündel historischer Verluste und institutioneller Steuerungsformen. Auf die physische Zerstörung und die nachkriegszeitliche Glättung folgt heute eine prozedurale Glättung: Entwurfsentscheidungen werden früh in Normen-, Nachweis- und Vergaberoutinen stabilisiert. Dadurch verschiebt sich die Priorität von räumlicher und materieller Ausformung hin zu Prüfbarkeit, Haftungssicherheit und Kalkulierbarkeit. Im Ergebnis lässt sich die aktuelle Fassadenproduktion als Form der Standardisierung unter regulatorischem und ökonomischem Druck beschreiben. Die zentralen Mechanismen sind die Fragmentierung von Verantwortung sowie die frühe Schließung von Entwurfsvarianten in abgestimmten Verfahren. Was verloren geht, ist nicht allein Dekor, sondern eine fein abgestufte Informations- und Maßstabsebene, die Stadträume historisch adressierbar und erinnerbar gemacht hat. Das Resultat wirkt häufig korrekt, doch steril und merkwürdig unbewohnt, als sei Wohnlichkeit ausgetrieben worden – eine Stadt als abgenommene Hülle.
Hier öffnet sich eine Ebene, die sich nur teilweise analytisch fassen lässt. Stadt wirkt leiblich und beeinflusst Körpergefühl, Stressniveau und Orientierung. Vertikale Fensterformate, Leibungstiefen, Schattenstaffelung, Rhythmus und Unterbrechung modulieren Wahrnehmung in einer Weise, die sich beschreiben, doch selten endgültig beweisen lässt. Daher stößt die vorliegende Textreihe an sprachliche Grenzen und mit ihnen an die Grenzen der Wahrnehmung.17 Daher sind Fragen einer Anthropologie des Bauens und der Wahrnehmungspsychologie von Architektur auch Gegenstand einer gesonderten Untersuchung. Während unsere Baugesetze und Effizienzstandards in immer kürzeren Zyklen mutieren, ist der menschliche Körper bis auf die durchschnittliche Körpergröße und Lebenserwartung über die letzten 150 Jahre nahezu identisch geblieben. Eine progressive Nostalgie erkennt darin kein Hindernis, sondern den Maßstab: Wenn wir uns heute auf die Qualitäten der Stadttextur von 1900 besinnen, dann nicht, um die Zeit anzuhalten, sondern um das Bauen wieder an jene biologischen Konstanten rückzubinden, die wir im Rausch der Normopathie unserer Baukultur schlicht vergessen haben.
Am Ende steht weniger eine Stilfrage, sondern eine beinahe theologische Frage der Raumordnung zwischen Leib, Seele und Zeit. Spürbar wird die gesamte Dimension der Fehlentwicklung in einer Baukultur, die nur noch auf Protokollierbarkeit, Nachweisführung, Normierung und Versicherung zugeschnitten ist. So werden Hüllen erzeugt — ohne Innerlichkeit, Räume ohne Zuspruch, Fassaden ohne Wärme. In ihr wächst die Kälte nicht trotz, sondern aus der Absicherung. Der Ausweg liegt nicht in noch feineren Kriterien, sondern in einer Rückbindung des Bauens an das, was der Körper sofort erkennt, bevor Begriffe folgen: Proportion als Ruhe, Schwelle als Einladung, Tiefe als Nähe; Rhythmus als Halt und Material als Gedächtnis. Dort, wo diese Elemente zusammenklingen, kehrt etwas zurück, das kein Gutachten stiften kann, aber jede bewohnbare Stadt braucht: ein stilles Einvernehmen zwischen Außen und Innen, zwischen öffentlicher Form und privatem Leben. Erst in diesem Einvernehmen verliert die schwarze Messe der Verfahren ihre Macht – nicht durch Streit, sondern durch Gegenwart; nicht durch Dekor, sondern durch Würde.

- Mit dem Begriff einer „überlieferten vorkriegszeitlichen Stadtextur“ ist vorliegend keine romantisch behauptete „Altstadt“ als geschlossenes Ganzes gemeint, sondern die materielle, parzellierte Stadtgestalt Berlins vor dem Zweiten Weltkrieg, vor allem die gründerzeitliche Mietshaus- und Blockrandstadt (Parzellenlogik, Höfe, Stuck- und Putzrelief, Straßenräume, Dichte) zuzüglich jener vorgründerzeitlichen Altstadtfragmente, die bereits weit vor dem Krieg einer Abriss- und Neugestaltungswelle zum Opfer fielen. Als Referenz für die (bewusst) sozial- und bodenpolitisch kritische Beschreibung eben dieses „steinernen“ Berlin — der Mietskaserne als System — vgl. Werner Hegemann, Das steinerne Berlin. Geschichte der größten Mietskasernenstadt der Welt, Berlin: Gustav Kiepenheuer, 1930. ↩︎
- Projektseite: Molkenmarkt Berlin. Online unter: https://molkenmarkt.berlin.de/ (Zugriff am: 17.12.2025).
BauNetz: Bericht/Überblick zum Molkenmarkt (Wettbewerb/Planung, mit Abbildungen/Visualisierungen). Online unter: https://www.baunetz.de/mobil/meldung.html?cid=8644960 (Zugriff am: 17.12.2025). ↩︎ - Landesdenkmalamt Berlin: „Das Archäologische Haus am Petriplatz“. Online unter: https://www.berlin.de/landesdenkmalamt/aktivitaeten/kurzmeldungen/2022/das-archaeologische-haus-am-petriplatz-1171556.php (Zugriff am: 17.12.2025).
PETRI Berlin: Projekt-/Ausstellungsseite „PETRI Berlin“ (Petriplatz, Archäologie, Bilder/Materialien je nach Unterseite). Online unter: https://petri.berlin/ (Zugriff am: 17.12.2025).
House of One: Projektseite „House of One“ (Petriplatz, Bau/Idee, Bilder/Updates). Online unter: https://house-of-one.org/de/ (Zugriff am: 17.12.2025). ↩︎ - In Berlin wird bekanntlich nicht nur am 1. Mai in Steinwürfen gemessen… ↩︎
- Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin: „Europacity“ (Umfeld Hauptbahnhof, Heidestraße/Invalidenstraße als Kontext). Online unter: https://www.berlin.de/sen/stadtentwicklung/staedtebau/umfeld-hauptbahnhof/europacity/ (Zugriff am: 17.12.2025).
die taz: „Quartier Heidestraße“ (Einordnung/Reportage; typischerweise mit Fotos). Online unter: https://taz.de/Quartier-Heidestrasse-in-der-Europacity/!6022492/ (Zugriff am: 17.12.2025). ↩︎ - Viele Fassaden und Quartiersbilder in der Berliner Mitte entstehen als Ergebnis gestufter Verfahren: Leitbilder und Masterpläne setzen den Rahmen, Baukollegium/Gestaltungsrunden justieren Typologien und Erscheinungsbild, und Bebauungsplanverfahren bündeln Gutachten sowie Abwägungen zu konkreten Festsetzungen. Das lässt sich am Molkenmarkt, am Petriplatz und im Umfeld der Heidestraße/Invalidenstraße anhand öffentlich dokumentierter Protokolle, Leitdokumente und Planunterlagen nachvollziehen. ↩︎
- Das historisierende Signal vieler Rekonstruktions- und Neubauprojekte entsteht heute weniger aus gewachsenen Eigentums- und Umbaupfaden als aus gesetzten Regeln. Für das Dom-Römer-Areal etwa fixiert die Stadt Frankfurt die erforderlichen Merkmale über eine Gestaltungssatzung, die Fassadengliederung, Dachformen und Materialvorgaben verbindlich normiert.
Stadt Frankfurt am Main: Gestaltungssatzung für das Dom-Römer-Areal, Frankfurt am Main 2010, online unter: https://www.domroemer.de/sites/default/files/field_download_file/gestaltungssatzung.pdf (letzter Zugriff: 02.12.2025).
Ergänzend zur Trennung von „Ortbetonkonstruktion“ (Tragwerk) und gemauerter Fassade; Beobachtung der auffälligen Planität/fehlenden „Unebenheiten“ als Rekonstruktionsdilemma vgl. Frank Peter Jäger: Centre Pompidou in barockem Gewand – Rekonstruktion Schloss Berlin, 23 September 2021, online unter: https://www.espazium.ch/de/aktuelles/rekonstruktion-schloss-berlin (letzter Zugriff 01.12.2025). ↩︎ - von eigener Art ↩︎
- Im Grunde lässt sich die Kritische Rekonstruktion – polemisch zugespitzt – als spätmoderne Neuauflage des Heimatschutzstils lesen – allerdings unter veränderten Mitteln: maßstäblich und typologisch der Unterordnung unter einen städtebaulichen Rahmen verpflichtet, der „die Geschichte des Ortes respektiert und neu interpretiert“. Ein solches Entwurfskonzept wurde etwa am Berliner Vinetaplatz mit der Wiederherstellung der Blockfigur im Rahmen des Ersten West-Berliner Stadterneuerungsprogramms (ab 1977) exemplarisch durchexerziert.
Josef Paul Kleihues: Die IBA vor dem Hintergrund der Berliner Architektur- und Stadtplanung des 20. Jahrhunderts. In: Vittorio Magnago Lampugnani (Hrsg.): Schriftenreihe zur Internationalen Bauausstellung Berlin. Die Neubaugebiete. Dokumente Projekte. Modelle für eine Stadt, Berlin 1984, S. 36. In: Gutachten 2010 zur IBA 1984/87, S. 21. ↩︎ - Große innerstädtische Entwicklungsflächen, die in kurzer Zeit an wenige Großakteure vergeben werden, begünstigen eher durchgängige Entwurfs- und Umsetzungslogiken als kleinteilige, über Jahrzehnte gestreckte Parzellenentwicklungen mit vielen Bauherren. Exemplarisch lässt sich diese Struktur am Potsdamer Platz nachvollziehen: Dort wird die Frage der Abgabe eines sehr großen Areals an wenige Investoren und die Realisierung in einer einzigen Bauphase ausdrücklich thematisiert.
Philipp Reinfeld: Sanierungskonzept Potsdamer Platz, Nürnberg 2006, online unter: https://bplus.xyz/downloads/0108_Disko_03.pdf (letzter Zugriff: 04. Dezember 2025).
Auch der 2025 verstorbene Architekt Hans Stimmann beschrieb in einem Interview mit Die Welt, dass es „nur zwei große Akteure“ gebe (kommunale Wohnungsbaugesellschaften und private Projektentwickler) und dass mittelständische Bauherren fehlen würden, einer der wichtigsten Treiber des gründerzeitlichen Baubooms.
Rainer Haubrich: „In Berlin ist auch vieles daneben gegangen“, Berlin 2015, online unter: https://www.welt.de/kultur/kunst-und-architektur/article148861477/In-Berlin-ist-auch-vieles-daneben-gegangen.html (letzter Zugriff: 13. Dezember 2025). ↩︎ - Der hier entdeckte Forschungsbericht diskutiert die Verringerung der lichten Raumhöhe sowie reduzierte Fenstermaße als konkrete Kostensenkungshebel und versucht nachzuzeichnen, warum innen bei knappen Zuschnitten häufiger niedrige bzw. in Teilbereichen eingeschränkt nutzbare Räume entstehen.
Menkhoff, Herbert / Brocher, Erichbernd / Ebert, Horst: Baukosteneinsparungen aus veränderten Baubestimmungen – Möglichkeiten und Grenzen, Hannover 1988, online unter: https://www.irbnet.de/daten/rswb/89009501018.pdf (letzter Zugriff: 11. November 2025).
Interessant ist an dieser Stelle, dass die enormen Raumhöhen vieler Altbauwohnungen einen sehr pragmatischen Hintergrund: In der Zeit von Öfen sowie Kerzen- und Gaslicht sollte das zusätzliche Luftvolumen die Rauch- bzw. Geruchsschichten in der Raumluft verdünnen. Die entsprechenden Partikel konnten sich eher oberhalb der Aufenthaltszone sammeln und über hohe Fenster besser abgeführt werden. Energetisch waren solche Räume im Winter allerdings eher nachteilig, weil Wärme bekanntlich nach oben steigt. Allerdings hat diese Bauweise den heute so geschätzten Nebeneffekt von mehr Licht, Luft und einem großzügig-herrschaftlichen Gesamteindruck. ↩︎ - Der „Sockel“ meint vorliegend eine aktivierte Erdgeschosszone, die den Übergang zwischen Straße und Haus organisiert: Eingänge, Vitrinen, Ladenflächen, Cafés, Adressbildung, Blickbeziehungen. Genau dort entscheidet sich, ob ein Gebäude als bewohnt wirkt – oder als Fläche, die niemandem gehört. In der Literatur zu Defensible Space und kriminalpräventiver Gestaltung wird dieser Unterschied als handfester Hebel gegen Sachbeschädigung/Vandalismus beschrieben. Parallel zeigen immobilienwirtschaftliche Arbeiten, dass funktionsgemischte, alltagsnahe Urbanitätmit einer höheren Zahlungsbereitschaft bzw. Wertstabilität korreliert, was sich als Indikator für erhöhte Nachfrage und stabilere Belegung lesen lässt.
Oscar Newman: Creating Defensible Space, Washington, D.C. 1996, online unter: https://www.huduser.gov/publications/pdf/def.pdf (letzter Zugriff: 22.03.2021). ↩︎ - [kt̪o vʲɪnɐˈvat] und [ʂto ˈdʲelətʲ] ↩︎
- Alexander Iwanowitsch Herzen (russ. Александр Иванович Герцен, IPA: [ɐlʲɪkˈsandər ɪvɐˈnovʲɪtɕ ˈɡʲert͡sən], 1812–1870; im Deutschen meist „Herzen“, streng nach dem Russischen eher „Gerzen“) war russischer Schriftsteller, Denker und politischer Emigrant – ein Mann, der Russlands Gegenwart stets mit dem Blick eines enttäuschten Liebhabers sezierte. In seinem Roman „Кто виноват?“ (IPA: [kt̪o vʲɪnɐˈvat]) schrieb er über Beziehungen und Milieus, in denen private Verstrickungen, Standesfragen und Prägung durch Erziehung so ineinandergreifen, dass die Schuldfrage selbst zum Symptom wird. ↩︎
- Nikolai Gawrilowitsch Tschernyschewski (russ. Николай Гаврилович Чернышевский, IPA: [nʲɪkɐˈlaj ɡɐvrʲɪˈɫovʲɪtɕ t͡ɕɪrnɨˈʂɛfskʲɪj], 1828–1889) war russischer Philosoph und Publizist; im Gefängnis schrieb er in seinem didaktischen Roman „Что делать?“ (IPA: [ʂto ˈdʲelətʲ]) u.a. über neue Lebensformen, Arbeitsethos, Handeln und seine Folgen sowie über Geschlechterfragen. Die ihm zugeschriebene programmatische Schärfe machte den Titel später zur Parole: Lenin griff ihn 1902 mit „Что делать?“ erneut auf und machte aus der literarischen Frage ein rhetorisches Markenzeichen, das gleichsam Kampfprogramm war. ↩︎
- In der deutschen Baupraxis wird seit Jahren thematisiert, dass technische Regeln und Baustandards (insbesondere die „anerkannten Regeln der Technik“) faktisch zum dominierenden Maßstab werden und damit Gestaltungsspielräume verengen. Genau diese Logik adressieren die Eckpunkte zum „Gebäudetyp E“, die ausdrücklich mehr Freiheit vom Regelwerk und von üblichen Baustandards eröffnen sollen. ↩︎
- Diese Aussage wird einer Paraphrase des in Großbritannien in den 1950er Jahren verstorbenen österreichischen Philosophen Ludwig Wittgenstein zugeschrieben. Im Tractatus logico-philosophicus lautet die Formulierung: „Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.“ – „Welt“ wird dabei häufig als Wahrnehmungs- und Deutungshorizont gelesen. Online: https://www.philosophische-psychologie.de/category/zeitgeist/ (Zugriff am: 17.12.2025).
Andere Quellen schreiben die Aussage aber oft Alexander von Humboldt (und seinem Bruder Wilhelm) zu, der das Fundament für diese Idee früher gelegt haben soll. Kurz gesagt, schrieb Wilhelm von Humboldt schrieb: „Die Sprache ist das bildende Organ des Gedanken.“ Ein Volk, das zehn Wörter für „Schnee“ hat, nimmt die Welt buchstäblich anders wahr als eines, das nur ein Wort dafür besitzt. ↩︎