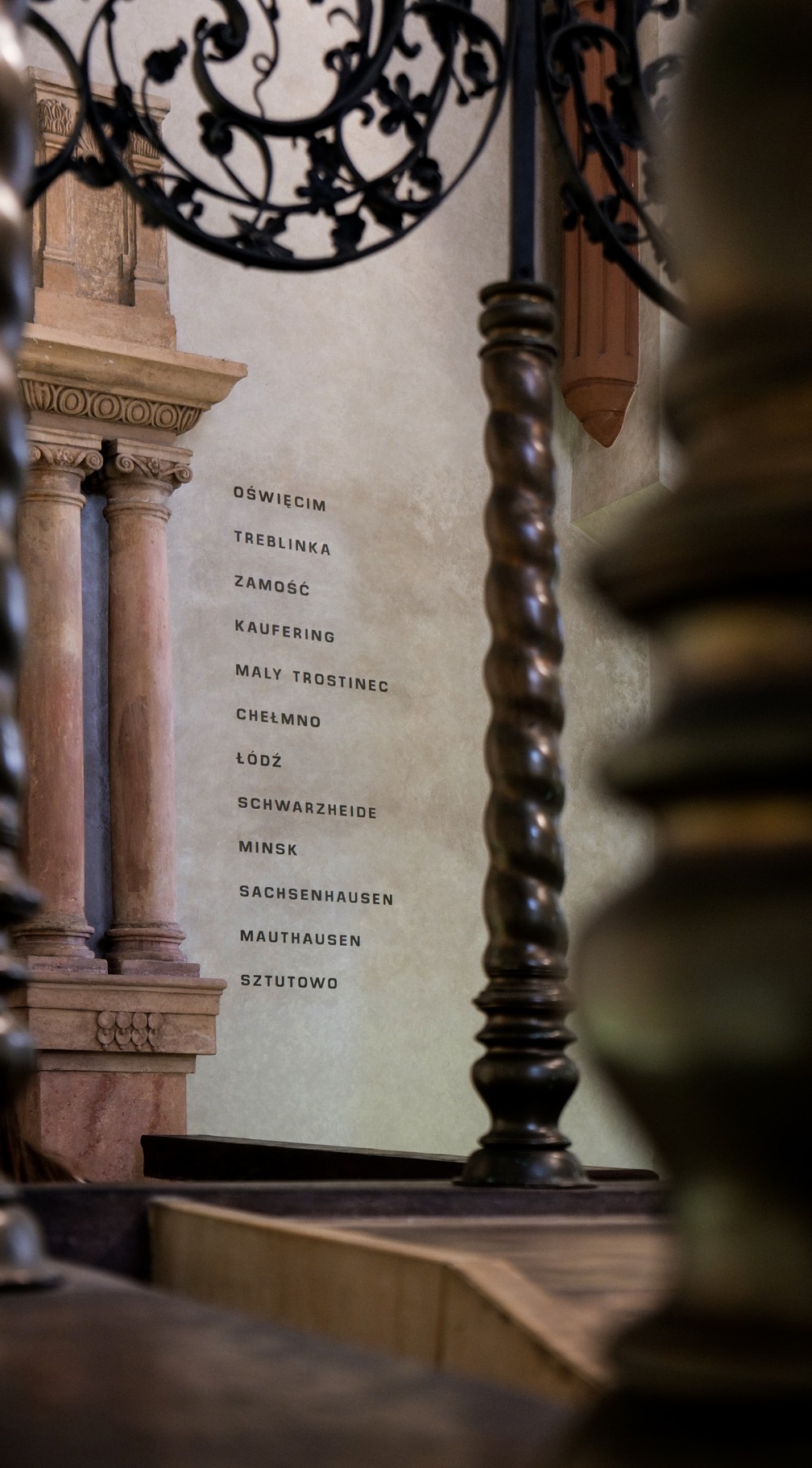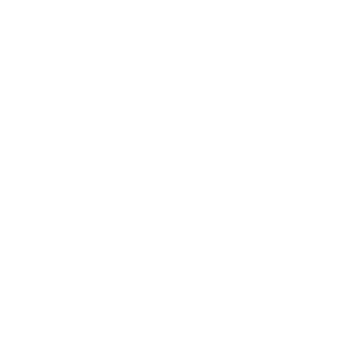Thomas Klatt von RBB Kultur über Repräsentation, Teilhabe und die Rolle der Architektur im Gedenken
Quelle: RBB Kultur, Sendung „Schalom“, 22. November 2022. Redaktion: Almut Engelien. Beitrag: Thomas Glatt über „Das Synagogenprojekt“ und ein Gespräch mit Daniel Yakubovich.
Hinweis zur Textgestalt
Der nachfolgende Beitrag beruht auf einem im Rundfunk ausgestrahlten Gespräch. Er stellt kein wortgetreues Transkript der Sendung dar, sondern eine eigenständige inhaltliche Wiedergabe des Autors. Der Text ist keine Veröffentlichung von RBB Kultur und steht in redaktioneller Verantwortung dieser Website.
Aus urheberrechtlichen Gründen werden die Aussagen der Beteiligten überwiegend paraphrasiert und in indirekter Rede wiedergegeben, teilweise zusammengefasst und kontextualisiert. Reihenfolge, Auswahl und Formulierungen folgen der inhaltlichen Struktur des Gesprächs, nicht der technischen Schnittfassung der Originalausstrahlung.
Ein Ausstellungsprojekt über zerstörte Synagogen
Ausgangspunkt der Sendung ist eine Ausstellung mit dem Titel „Das Synagogenprojekt“, gezeigt im Berliner Abgeordnetenhaus und parallel im Internet. Vorgestellt werden studentische Entwürfe für Rekonstruktion oder Neubau von drei im Novemberpogrom 1938 zerstörten Synagogen – darunter die große Synagoge am Berliner Fraenkelufer. Einleitende politische Stimmen erinnern an die Brandanschläge von 1938, an den späteren Abriss der Ruinen und an die heutige Situation: eine wachsende Gemeinde, die räumlich an ihre Grenzen stößt. Der Radiobeitrag beschreibt die studentischen Entwürfe als Bandbreite zwischen zurückhaltend und selbstbewusst: Es handelt sich um einen Ideenwettbewerb, keine konkrete Bauplanung, überwiegend modern in der Anmutung und gespickt mit historischen Zitaten.
Ein beteiligter Architekturprofessor weist im Gespräch darauf hin, dass vielen Lehrenden und Studierenden sowohl jüdisches Leben als auch die liturgische Dimension weitgehend fremd seien. Gleichzeitig betont er die Schwierigkeit, mit der „zeichenhaften Wirkung“ architektonischer Bilder umzugehen – eine Ebene, die in der gegenwärtigen Architekturlehre ungewohnt geworden sei.
Diese Selbstbeschreibung markiert einen Ausgangspunkt: Entwürfe für jüdische Sakralräume werden weitgehend von nicht-jüdischen Akteuren entwickelt, die ihre eigene Distanz ausdrücklich benennen – ohne dass dies im Beitrag kritisch vertieft würde.
„Kein einziger jüdischer oder israelischer Student“
An dieser Stelle setzt die Stimme von Daniel Yakubovich ein, der im Beitrag als jüdischer Architekturabsolvent aus Berlin vorgestellt wird. Er hat eine Masterarbeit zum geplanten Wiederaufbau der Synagoge am Fraenkelufer vorgelegt, die einen eigenständigen Gegenentwurf zur Rekonstruktionsidee formuliert. Dass seine Arbeit nicht Teil des Synagogenprojekts ist, wird im Radiobeitrag als Ausgangspunkt seiner Kritik benannt.
Yakubovich selbst formuliert es so: „Kein einziger jüdischer oder israelischer Student aus Berlin ist unter den ausgestellten Entwürfen vertreten – dabei wäre es gerade ihre Perspektive, die in der Frage, wie Synagogen in einer heutigen demokratischen Gesellschaft architektonisch gedacht werden können, unerlässlich gewesen wäre.“
Der Beitrag verweist darauf, dass in der sichtbaren Ergebnisfläche – den gezeigten Entwürfen – eine originäre jüdisch-berlinerische Perspektive fehlt. „Auffällig ist, dass keine der vier Berliner Architekturfakultäten – weder die UdK noch die TU Berlin, noch die ehemalige Beuth-Hochschule oder die University of Applied Sciences – in die Ausstellung einbezogen wurde. Das wirft Fragen auf, gerade im Hinblick auf die Einbindung lokaler Perspektiven aus Kiez, Stadtgesellschaft und jüdischer Community.“
Damit steht im Raum, dass in einem Projekt, das sich explizit mit jüdischer Baukultur befasst, weder lokale Hochschulen noch jüdische oder israelische Studierende aus Berlin strukturell eingebunden wurden – eine Leerstelle, die der Radiobeitrag benennt, aber nicht weiter kommentiert.
Synagogen entwerfen – mit wem und für wen?
Zwischen den politischen Einordnungen, der Präsentation der studentischen Entwürfe und den O-Tönen aus der Architekturszene zeichnet die Sendung ein Bild, in dem über jüdische Orte in erster Linie von außen gesprochen wird.
Yakubovichs Intervention richtet sich weniger gegen die Studierenden selbst als gegen den institutionellen Rahmen, in dem sie arbeiten: gegen eine Konstellation, in der Synagogen als symbolisch hoch aufgeladene Aufgaben bearbeitet werden, ohne dass jüdische Sprechpositionen strukturell beteiligt sind – weder auf Seiten der Lehrenden noch der Entwerfenden. Übertragen auf das Synagogenprojekt bedeutet dies: Wenn Entwurf und Deutungshoheit über jüdische Erinnerungsräume weitgehend in nicht-jüdischen Händen liegen, droht eine Architektur ohne religiöse Grammatik zu entstehen – und ein Erinnerungsbau, der mehr über die Institutionen erzählt, die ihn verantworten, als über die Gemeinschaft, deren Geschichte er berührt.
„Bis zum Baubeginn scheint es noch Gesprächsbedarf zu geben“
Gegen Ende des Radiobeitrags wird zusammenfassend festgestellt, dass bis zum Baubeginn am Fraenkelufer noch „Gesprächsbedarf“ bestehe. Die Formulierung deutet eine Spannung an, ohne sie weiter auszubuchstabieren: Zwischen gut gemeinter Sichtbarkeit, politischer Symbolik, akademischen Ideenskizzen und der tatsächlichen Teilhabe derjenigen, für die Synagogen konkrete religiöse und soziale Räume sind. Die RBB-Sendung macht diesen Konflikt sichtbar, ohne ihn ganz auszutragen. Der hier dokumentierte Beitrag versucht, die im Radiobeitrag angelegten Linien nachzuzeichnen und zugleich jene Stimmen zu verstärken, die im Synagogenprojekt selbst nur am Rand vorkommen: die Perspektiven jüdischer Architekten, Forscher und Gemeinden, deren Teilhabe im Entwerfen und Deuten jüdischer Architektur keine Ausnahme, sondern Voraussetzung sein müsste.
Quelle: RBB Kultur, Sendung „Schalom“, 22. November 2022. Redaktion: Almut Engelien. Beitrag: Thomas Glatt über das Synagogenprojekt und ein Gespräch mit Daniel Yakubovich.
Nachbemerkung
Die folgende Kritik spiegelt die Perspektive des Autors und versteht sich als Beitrag zur medienkritischen Einordnung der Sendung:
Die RBB-Sendung „Schalom“ vom 22. November 2022 widmete sich unter dem Titel „Das Synagogenprojekt“ einer Ausstellung studentischer Entwürfe für den Wiederaufbau historischer Synagogen in Berlin und Hamburg – mit Fokus auf die Synagoge am Fraenkelufer. Was als Beitrag zu einem differenzierten Erinnerungsdiskurs intendiert war, offenbart in Aufbau und Auswahl zentrale blinde Flecken: eine strukturelle Auslassung jüdischer Sprechpositionen in einer Debatte, die sich explizit um jüdische Orte, jüdisches Gedenken und jüdisches Gemeindeleben dreht.
Die Redaktion wählt einen Erzählrahmen, der sich auf eine Aneinanderreihung wohlmeinender Stimmen beschränkt: politische Repräsentation (Dennis Buchner), architektonische Außenperspektive (Jörg Springer), journalistische Rahmung (Thomas Klatt, Almut Engelien). Was fehlt, ist eine tiefergehende Auseinandersetzung mit der Frage, wer spricht, für wen und auf welcher Grundlage. Zwar wird auf das wachsende Gemeindeleben am Fraenkelufer verwiesen – doch die Perspektiven der betroffenen Gemeinde selbst, ebenso wie jüdischer Stimmen innerhalb des architektonischen Diskurses, erscheinen im Beitrag lediglich marginalisiert oder nachträglich kommentierend. Die Tatsache, dass weder Berliner Architekturhochschulen noch jüdische oder israelische Studierende in das Projekt einbezogen wurden, wird zwar im Beitrag benannt, bleibt aber journalistisch weitgehend unkommentiert.
Aus Sicht des Autors wäre es Aufgabe der Redaktion gewesen, diese Leerstelle nicht nur zu benennen, sondern zu kontextualisieren: Warum wird jüdische Teilhabe in einem Synagogenprojekt zur Ausnahme? Welche Mechanismen des Sprechens über, statt mit jüdischen Akteuren sind hier wirksam? Und inwiefern reproduziert auch die Berichterstattung diese Strukturen? Besonders augenfällig wird diese Asymmetrie in den zitierten Aussagen von Jörg Springer. Die Feststellung, man sei „mit jüdischem Leben oder gar der Liturgie wenig vertraut“ und habe Mühe mit der „zeichenhaften Wirkung architektonischer Bilder“, wird unkommentiert stehen gelassen – und wirkt im Duktus des Beitrags eher wie eine Entlastung. Dass die Projektleitung einer hochsymbolischen Bauaufgabe wie einer Synagoge überlassen wird, ohne reflektierten Umgang mit liturgischen, historischen oder gemeinschaftsspezifischen Fragen, wäre hingegen Anlass zur journalistischen Nachforschung gewesen.
Dabei mangelt es keineswegs an Fachpersonen, die im Bereich Synagogenbau und jüdischer Sakralarchitektur in Deutschland forschen, entwerfen oder publizieren und sich mit einer hinreichend fundierten Expertise in die Debatte oder gar in ein universitäres Entwurfsprojekt hätten einbringen lassen. Zu nennen sind etwa der Architekt Kay Zareh (Berlin), der über Jahre hinweg historische Synagogenbauten saniert hat; die Judaistin und Architekturhistorikerin Dr. Rachel Heuberger (Frankfurt), die sich mit Raumkonzepten jüdischer Versammlungsorte im deutschsprachigen Raum befasst; oder der Historiker Prof. Dr. Julius H. Schoeps, der zur politischen Symbolik jüdischer Bauformen publiziert hat. Auch Prof. Johannes Modrescu (Technische Hochschule Köln), Mitautor eines Standardwerks zum Verhältnis von Raum und Ritual im modernen Synagogenbau, hätte als beratender Kopf oder kritische Stimme hinzugezogen werden können. Sie alle sind ausgewiesene Kenner jüdischer Baukultur – und verfügen im Unterschied zu den Studierenden über eine deutlich fundiertere architektonische wie liturgische Expertise.
Stattdessen jedoch werden in mehreren studentischen Entwürfen – etwa im Umfeld der Weimarer Beiträge – offensichtliche Bezugnahmen auf japanische Schreine durchgewunken, ohne dass eine einzige kritische Intervention von Seiten der Lehrenden dokumentiert wäre. Dass ein Architekturprofessor wie Jörg Springer öffentlich zugibt, auf dem von ihm unterrichteten Gebiet nicht ausreichend bewandert zu sein und dabei nicht durch kollegiale Ergänzung, externe Expertise oder redaktionelle Einordnung relativiert wird, verweist auf ein tieferliegendes Problem. Es geht weniger um Unkenntnis als um die Leerstelle, die sich einstellt, wenn niemand widerspricht. Die Folge ist eine Architektur ohne religiöse Grammatik, eine Rekonstruktion ohne historische Differenzierung – und ein Erinnerungsbau ohne Erinnerung.
So bleibt die Sendung im Bemühen um Versöhnung letztlich unentschieden: zwischen gut gemeinter Sichtbarkeit und einer unbewussten Reproduktion jener strukturellen Ausgrenzung, die sie eigentlich überwinden möchte.
Siehe auch: